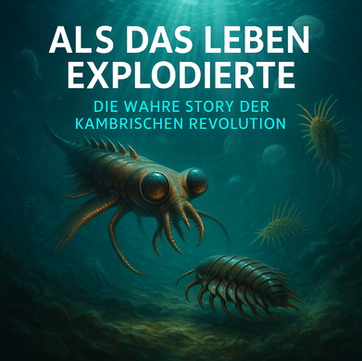Der circadiane Rhythmus, abgeleitet von den lateinischen Wörtern "circa" (ungefähr) und "dies" (Tag), bezeichnet eine endogene, etwa 24 Stunden dauernde biologische Rhythmik, die in nahezu allen Lebewesen – von Bakterien über Pflanzen bis hin zu Tieren und Menschen – beobachtet wird. Diese inneren Uhren ermöglichen es Organismen, physiologische und Verhaltensprozesse an den täglichen Wechsel von Licht und Dunkelheit anzupassen. Sie sind von grundlegender Bedeutung für die Organisation des Lebens und die Aufrechterhaltung der Homöostase.
Beim Menschen wird der zentrale Taktgeber des circadianen Rhythmus als suprachiasmatischer Nucleus (SCN) bezeichnet, ein kleiner Bereich im Hypothalamus des Gehirns. Der SCN empfängt direkte Lichtinformationen über den Retinohypothalamischen Trakt aus speziellen Ganglienzellen der Netzhaut. Diese Lichtsignale dienen als wichtigster "Zeitgeber" und synchronisieren die innere Uhr mit dem 24-Stunden-Tag. Obwohl der Rhythmus endogen ist und auch ohne äußere Zeitgeber weiterläuft (dann oft leicht von 24 Stunden abweichend), ist die tägliche Anpassung durch Licht entscheidend für seine Präzision.
Der circadiane Rhythmus steuert eine Vielzahl von Körperfunktionen. Am bekanntesten ist der Schlaf-Wach-Rhythmus, aber auch die Körpertemperatur, die Hormonausschüttung (z.B. Melatonin, Cortisol, Wachstumshormone), der Blutdruck, die Herzfrequenz, der Stoffwechsel, die Immunfunktion und sogar kognitive Leistungen unterliegen einer tageszeitlichen Schwankung. Beispielsweise steigt die Melatoninproduktion bei Dunkelheit an und signalisiert dem Körper Schlafbereitschaft, während Cortisol am Morgen seinen Höhepunkt erreicht und zur Wachheit beiträgt.
Auf molekularer Ebene wird der circadiane Rhythmus durch ein komplexes Netzwerk von sogenannten "Uhrgenen" und ihren Proteinprodukten reguliert. Diese Gene (wie Period, Cryptochrome, Clock und Bmal1) bilden in den Zellen eine transkriptionelle/translationale Rückkopplungsschleife, die zu oszillierenden Proteinspiegeln über einen Zeitraum von etwa 24 Stunden führt. Diese molekularen Oszillationen in den einzelnen Zellen steuern wiederum die Expression zahlreicher nachgeschalteter Gene und regulieren so die zellulären und systemischen circadianen Rhythmen.
Störungen des circadianen Rhythmus können erhebliche negative Auswirkungen auf die Gesundheit haben. Beispiele hierfür sind Jetlag bei schnellen Zeitzonenwechseln, die Schichtarbeit mit ihren chronischen Desynchronisationen oder Schlafstörungen wie die Schlafphasenverschiebung. Langfristige Störungen werden mit einem erhöhten Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Stoffwechselstörungen (wie Diabetes), bestimmte Krebsarten, psychische Erkrankungen (z.B. Depressionen) und eine allgemeine Verschlechterung des Wohlbefindens in Verbindung gebracht. Die Beachtung und Unterstützung des natürlichen circadianen Rhythmus durch gute Schlafhygiene, regelmäßige Tagesabläufe und ausreichende Exposition gegenüber natürlichem Licht sind daher essenziell für die Erhaltung der Gesundheit.