Unser Immunsystem: Ein Erbe von Neandertalern, Mikroben und Millionen Jahren Evolution
- Benjamin Metzig
- 5. Mai 2025
- 12 Min. Lesezeit

Hast du dich jemals gefragt, warum dein Körper auf eine bestimmte Art auf Krankheitserreger reagiert, warum manche Menschen anfälliger für Allergien sind als andere, oder woher unsere Abwehrkräfte eigentlich kommen? Die Antwort ist keine einfache, geradlinige Geschichte. Vielmehr ist unser Immunsystem ein unglaublich komplexes Mosaik, geformt über Millionen von Jahren durch ständige Interaktion mit unserer Umwelt, unzähligen Mikroben und – halt dich fest – sogar durch Begegnungen mit unseren ausgestorbenen Verwandten wie den Neandertalern! Es ist keine starre Festung, sondern ein dynamisches Schlachtfeld und ein lebendiges Geschichtsbuch zugleich, das die Spuren unserer evolutionären Reise in sich trägt. Die grundlegende Aufgabe, zwischen „Freund“ (körpereigen) und „Feind“ (fremd) zu unterscheiden, um uns vor Pathogenen zu schützen und unsere körperliche Integrität zu wahren, ist natürlich der Kern des Ganzen. Aber wie genau hat sich dieses System zu dem entwickelt, was es heute ist? Komm mit auf eine Entdeckungsreise, die uns von den Anfängen des Lebens bis zu den neuesten Erkenntnissen der Genomik führt und zeigt, wie tief unsere Vergangenheit unsere heutige Gesundheit beeinflusst.
Die Geschichte unserer Abwehrkräfte beginnt nicht erst mit uns Menschen oder Säugetieren, sondern wurzelt tief in der Evolution des Lebens selbst. Schon die allereinfachsten Organismen mussten Wege finden, ihre zelluläre Integrität zu schützen. Denk mal an die Phagozytose – das buchstäbliche „Verschlingen“ von Partikeln. Ursprünglich war das für Einzeller ein Weg zur Nahrungsaufnahme, aber dieses clevere Prinzip wurde schon früh für Abwehrzwecke umfunktioniert und ist bis heute ein Kernbestandteil unserer angeborenen Immunantwort! Wenn wir zu den Wirbellosen schauen, sehen wir bereits erstaunlich vielfältige Strategien: robuste Chitinpanzer bei Insekten, Schleimsekretion bei Weichtieren, und patrouillierende Immunzellen wie Amöbozyten, die Fremdkörper erkennen und beseitigen. Diese Erkennung funktioniert über spezielle Rezeptoren, die wie molekulare Fühler nach Mustern suchen, die typisch für Mikroorganismen sind (sogenannte PAMPs). Wenn diese Rezeptoren anschlagen, wird eine Kaskade ausgelöst, die antimikrobielle Substanzen freisetzt. Einige Wirbellose, wie die Seeigel, besitzen sogar eine riesige Anzahl solcher Rezeptorgene, was auf eine hochentwickelte angeborene Abwehr schließen lässt! Diese angeborene Immunität ist das Fundament, auf dem alles Weitere aufbaut – schnell, aber relativ unspezifisch.

Der wirklich revolutionäre Schritt in der Evolution der Immunität fand dann vor etwa 500 Millionen Jahren mit dem Aufkommen der Wirbeltiere statt. Zusätzlich zur bewährten angeborenen Abwehr entwickelten unsere Vorfahren ein völlig neues System: die adaptive Immunität. Das ist der Teil unseres Immunsystems, der lernen kann, sich spezifisch an bestimmte Erreger zu erinnern und bei erneutem Kontakt viel schneller und stärker zu reagieren. Stell dir das vor: ein Immunsystem mit Gedächtnis! Was war der Auslöser für diesen Quantensprung? Zwei genetische Großereignisse scheinen entscheidend gewesen zu sein. Erstens, die „Invasion“ eines springenden Gens, eines sogenannten Transposons (RAG). Dieses Transposon brachte quasi zufällig die molekularen Werkzeuge mit, um unsere Immunzell-Gene (für Antikörper und T-Zell-Rezeptoren) neu zu mischen und so eine schier unendliche Vielfalt an spezifischen Erkennungsmolekülen zu erzeugen. Ein genetischer Glücksfall mit weitreichenden Folgen! Zweitens fanden etwa zur gleichen Zeit wahrscheinlich zwei Runden einer kompletten Genomverdopplung (WGD) statt. Das vervielfachte das gesamte Erbgut und lieferte das genetische Rohmaterial – die Bausteine – für die Entwicklung komplexer Systeme wie MHC-Moleküle zur Antigenpräsentation und spezialisierte Immunzellen wie T- und B-Lymphozyten. Ohne diese beiden Ereignisse sähe unser Immunsystem heute vermutlich völlig anders aus!
Diese Entwicklung verlief dabei schrittweise und modular. Nicht alle Komponenten des adaptiven Systems entstanden gleichzeitig. Die verschiedenen Klassen von Antikörpern (Immunglobuline) traten nacheinander auf der evolutionären Bühne auf: IgM findet man schon bei Fischen, IgG kam bei Amphibien hinzu, IgA erst bei Vögeln und Säugern, und IgE ist auf Säugetiere beschränkt. Auch spezialisierte Organe wie der Thymus, die „Schule“ für T-Zellen, entwickelten sich parallel. Wichtig ist dabei: Das neue adaptive System hat die alte angeborene Immunität nicht ersetzt, sondern sich darauf aufgebaut. Beide Systeme arbeiten heute Hand in Hand, sind eng miteinander vernetzt und voneinander abhängig. Signale aus der angeborenen Abwehr sind oft entscheidend, um die adaptive Antwort überhaupt erst in Gang zu setzen und zu steuern. Es ist ein faszinierendes Beispiel dafür, wie Evolution auf Bestehendem aufbaut und durch Kombination und Modifikation neue, komplexere Funktionen hervorbringt.
Schlüsselmeilensteine in der Evolution des Immunsystems
Evolutionäre Ära/Gruppe | Wichtige Immunentwicklungen/Merkmale | Relevante Genetische Ereignisse (falls zutreffend) |
Prokaryoten | Restriktions-Modifikations-Systeme, CRISPR-Cas (erworbene Immunität gegen Phagen) | - |
Einzellige Eukaryoten | Phagozytose (ursprünglich Nahrung), RNA-Interferenz | - |
Wirbellose (Invertebraten) | Physikalische Barrieren (Schleim, Chitin), Phagozytische Zellen (Amöbozyten etc.), PRRs (TLRs, NLRs), PAMP-Erkennung, Antimikrobielle Peptide, Komplement-Vorläufer | Gen-Duplikationen (z.B. TLRs) |
Kieferlose Wirbeltiere (Agnathen) | Lymphozyten-ähnliche Zellen, Variable Lymphozyten-Rezeptoren (VLRs), Thymus-ähnliche Strukturen | Konvergente Evolution des VLR-Systems |
Kiefermäuler (Gnathostomen) | T- und B-Lymphozyten, MHC, TCR, BCR (IgM), Somatische V(D)J-Rekombination, Thymus, Milz, Immunologisches Gedächtnis | RAG-Transposon-Integration, 2R WGD |
Tetrapoden | Vollständiges Immunsystem (Lymphknoten), IgG-Antikörper | Weitere Diversifizierung |
Vögel & Säugetiere | IgA-Antikörper | - |
Säugetiere | IgE-Antikörper, Verfeinerung der Immunregulation | - |
Jetzt wird es aber noch spannender, denn die Evolution unseres Immunsystems hörte nicht bei den frühen Wirbeltieren auf. Sie wurde maßgeblich weitergeformt durch die Wanderungen unserer eigenen Art, Homo sapiens, und die Begegnungen mit anderen Menschenformen. Als unsere Vorfahren vor etwa 60.000 bis 40.000 Jahren Afrika verließen und nach Eurasien kamen, trafen sie dort auf Neandertaler und Denisovaner, die sich schon Hunderttausende von Jahren an die dortigen Bedingungen angepasst hatten. Und was passierte? Sie vermischten sich! Dank der Analyse alter DNA wissen wir heute, dass im Genom aller nicht-afrikanischen Menschen etwa 1-4% Neandertaler-DNA steckt, bei manchen asiatischen und ozeanischen Populationen kommt noch Denisovaner-DNA hinzu. Dieser Genfluss durch Vermischung nennt sich Introgression. Natürlich wurde nicht alles behalten – vieles war im modernen menschlichen Hintergrund nachteilig und wurde wieder aussortiert. Aber einige dieser archaischen Genvarianten boten offenbar einen so großen Vorteil, dass sie sich durch positive Selektion in den menschlichen Populationen anreicherten. Man spricht hier von adaptiver Introgression.
Und rate mal, welche Gene besonders häufig Spuren dieser adaptiven Introgression zeigen? Genau: Immungene! Das ist ein starker Hinweis darauf, dass die Anpassung an neue, lokale Krankheitserreger in Eurasien eine der größten Herausforderungen für die einwandernden modernen Menschen war. Die Übernahme bereits erprobter Immun-Allele von Neandertalern und Denisovanern war quasi eine evolutionäre Abkürzung, ein Turbo für das Immunsystem im Kampf gegen unbekannte Viren, Bakterien und Parasiten. Stell dir vor, unsere Vorfahren bekamen durch diese Vermischung quasi ein genetisches „Update“ für ihre Abwehrkräfte, das ihnen half, in der neuen Umgebung zu überleben. Diese Erkenntnis ist doch absolut faszinierend, oder? Sie zeigt, dass unsere Geschichte und unsere Biologie untrennbar mit der Geschichte dieser ausgestorbenen Verwandten verwoben sind.

Konkret wurden mehrere Immungene identifiziert, die wir von Neandertalern oder Denisovanern geerbt haben und die uns wahrscheinlich geholfen haben: Dazu gehören Gene für Toll-Like Rezeptoren (TLR1, TLR6, TLR10), die Bakterien und Pilze erkennen, und der OAS-Gencluster, der für die Abwehr von Viren wichtig ist. Studien deuten darauf hin, dass diese archaischen Varianten oft mit einer stärkeren Immunantwort verbunden sind. Beispielsweise scheinen Träger bestimmter Neandertaler-OAS-Varianten eine deutlich robustere Reaktion auf Influenzaviren zu zeigen. Auch Gene, deren Proteine generell mit Viren interagieren (VIPs), sind in den von Neandertalern geerbten DNA-Abschnitten überrepräsentiert. Das passt zur „Gift-Gegengift“-Hypothese: Man tauschte nicht nur Krankheitserreger aus, sondern auch die passenden Abwehrgene dazu. Aber dieses Erbe ist ein zweischneidiges Schwert. Dieselben Genvarianten, die uns einst vor Pathogenen schützten, scheinen heute in unserer modernen Welt das Risiko für Allergien und Autoimmunerkrankungen wie Morbus Crohn oder Lupus zu erhöhen. Was früher ein Vorteil war, kann heute, in einer anderen Umwelt und mit einem anderen Lebensstil, zu einer überschießenden oder fehlgeleiteten Immunreaktion führen. Ein klassischer Fall von „evolutionärem Mismatch“.
Wichtige archaisch introgressierte Immungene und ihre Funktionen
Gen/Locus | Archaische Quelle | Putative Adaptive Funktion | Assoziierte Moderne Merkmale/Krankheiten |
TLR1/6/10 Cluster | Neandertaler, Denisovan | Erkennung bakterieller/fungaler Komp. | Allergien, Entzündungsregulation (populationsspez.) |
OAS Cluster | Neandertaler, Denisovan | Antivirale Abwehr | COVID-19 Risiko/Schutz, Influenza-Antwort |
STAT2 | Neandertaler | Interferon-Signalweg (Antiviral) | Immunantworten |
HLA Varianten | Neandertaler, Denisovan | Antigenpräsentation (Adaptive Imm.) | Autoimmunität, Infektionsabwehr |
VIPs (allgemein) | Neandertaler | Abwehr v.a. gegen RNA-Viren | Immunantworten, potenziell Autoimmunität/Allergien |
CCR9/CXCR6 | Neandertaler | Lymphozyten-Migration | COVID-19 Risiko (Nähe zu CCR9), Immunfunktionen |
IL-6 Pathway | Neandertaler | Entzündungsregulation | Endometriose (Ostasiaten), Entzündungsreaktionen |
Neben unserer Genetik und unserer evolutionären Vergangenheit gibt es aber noch einen weiteren, unglaublich wichtigen Spieler, der unser Immunsystem tagtäglich formt: unsere körpereigenen Mikroorganismen, das Mikrobiom! Billionen von Bakterien, Viren und Pilzen leben auf und in uns, vor allem im Darm. Und sie sind weit mehr als nur passive Mitbewohner. Wir haben uns über riesige Zeiträume gemeinsam mit ihnen entwickelt – wir sind quasi ein „Holobiont“, eine Einheit aus Wirt und Mikroben. Unser Immunsystem hat gelernt, diese nützlichen oder harmlosen Kommensalen nicht nur zu tolerieren, sondern aktiv mit ihnen zusammenzuarbeiten, um eine gesunde Balance aufrechtzuerhalten. Diese Beziehung ist eine echte Symphonie der Koevolution!
Besonders prägend ist diese Interaktion in der frühen Kindheit. Die ersten Lebensjahre sind ein kritisches Zeitfenster, in dem das Mikrobiom aufgebaut wird und das Immunsystem sozusagen „programmiert“ wird. Schon die Art der Geburt (vaginal oder Kaiserschnitt) beeinflusst, welche Mikroben uns zuerst besiedeln. Stillen liefert nicht nur Nahrung, sondern auch spezielle Zucker, die das Wachstum nützlicher Bifidobakterien fördern, und mütterliche Antikörper.

Diese frühe mikrobielle Exposition ist entscheidend: Sie stimuliert die Entwicklung von Immunstrukturen im Darm, hilft bei der Kalibrierung der Immunantwort (dem Gleichgewicht zwischen verschiedenen Immunzelltypen) und lehrt das Immunsystem, harmlose von gefährlichen Mikroben zu unterscheiden und Toleranz zu entwickeln. Man kann sagen, unsere frühen mikrobiellen Mitbewohner sind die ersten Trainer unseres Immunsystems! Wenn du übrigens mehr solcher tiefen Einblicke in die faszinierende Welt unserer Biologie und Gesundheit bekommen möchtest, dann melde dich doch für unseren monatlichen Newsletter über das Formular oben auf der Seite an – da warten noch viele spannende Geschichten auf dich!
Wichtige Faktoren der frühen Mikrobiom-Immun-Prägung
Geburtsmodus: Vaginale Geburt führt zu einer Besiedlung mit mütterlicher Vaginal- und Darmflora (z.B. Lactobacillus, Prevotella), Kaiserschnitt eher mit Hautmikroben (z.B. Staphylococcus) und verzögert die Etablierung wichtiger Darmbakterien wie Bifidobacterium und Bacteroides.
Säuglingsernährung: Muttermilch enthält präbiotische Oligosaccharide (HMOs), Antikörper (sIgA) und andere immunmodulierende Faktoren, die das Wachstum nützlicher Bakterien fördern und das Immunsystem direkt beeinflussen. Formula-Nahrung führt zu einer anderen Mikrobiom-Zusammensetzung.
Umweltfaktoren: Kontakt mit Geschwistern, Haustieren, der natürlichen Umwelt (Erde, Pflanzen) und die frühe Ernährungsvielfalt beeinflussen die Diversität und Zusammensetzung des sich entwickelnden Mikrobioms.
Antibiotikaeinsatz: Antibiotika können das frühe Mikrobiom empfindlich stören und langfristige Auswirkungen auf die Immunentwicklung haben.
Die Kommunikation zwischen Mikrobiom und Immunsystem ist unglaublich raffiniert und läuft über verschiedene Wege. Ein Hauptweg sind Stoffwechselprodukte der Mikroben. Kurzkettige Fettsäuren (SCFAs) wie Butyrat, die beim Abbau von Ballaststoffen entstehen, sind hier Superstars: Sie ernähren unsere Darmzellen, stärken die Darmbarriere und wirken entzündungshemmend, indem sie die Entwicklung von regulatorischen T-Zellen (Tregs) fördern – das sind die Friedenswächter unseres Immunsystems. Aber auch direkte Interaktionen spielen eine Rolle: Bestandteile von Mikrobenzellwänden werden von unseren Immunzellen erkannt und lösen Signale aus, die die Immunantwort feinjustieren. Eine gesunde Mikrobiota hilft zudem, die Darmbarriere intakt zu halten – wie eine Art lebende Firewall, die verhindert, dass zu viele Mikroben oder ihre Bestandteile ins Körperinnere gelangen und dort ständig Entzündungen auslösen. Das Immunsystem agiert hierbei wie ein Gärtner, der die Zusammensetzung der Mikrobengemeinschaft mitgestaltet, und gleichzeitig wie ein Türsteher. Diese dynamische Interaktion hält ein Leben lang an und ist entscheidend für unsere Gesundheit. Gerät dieses Gleichgewicht aus den Fugen (Dysbiose), etwa durch schlechte Ernährung, Stress oder Antibiotika, kann das zu einer Fehlregulation des Immunsystems führen und mit chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen, Allergien, Autoimmunerkrankungen und sogar Stoffwechselstörungen in Verbindung gebracht werden.

Parallel zu dieser Koevolution mit unseren nützlichen Mikroben tobt ein ständiger Wettlauf mit den „Bösen“ – den Krankheitserregern. Infektionskrankheiten waren und sind eine der mächtigsten Triebfedern der Evolution, die unser Immunsystem geformt haben. Es ist ein ewiges Wettrüsten: Wir entwickeln Abwehrmechanismen, die Pathogene entwickeln Strategien, um diesen zu entkommen (z.B. durch schnelle Veränderung ihrer Oberfläche oder durch Unterdrückung der Immunantwort). Dieser ständige Druck hat dazu geführt, dass sich Immunsysteme in verschiedenen menschlichen Populationen, die unterschiedlichen Pathogenen ausgesetzt waren, auch unterschiedlich angepasst haben. Das bekannteste Beispiel ist die Sichelzellanämie, die in Malariagebieten häufiger ist, weil sie einen gewissen Schutz vor schwerer Malaria bietet. Auch die von Neandertalern geerbten Immun-Allele sind ein Beispiel für solche lokalen Anpassungen an Pathogene in Eurasien. Die Notwendigkeit, eine riesige Vielfalt an Pathogenen mit unterschiedlichen Angriffsstrategien abwehren zu können, ist wahrscheinlich auch ein Grund dafür, warum viele unserer Immungene, wie die MHC-Gene, so unglaublich variabel sind – Vielfalt in der Abwehr ist der Schlüssel zum Überleben der Population.
Beispiele für Pathogen-Strategien zur Immunevasion
Antigenvariation: Schnelle Veränderung von Oberflächenmolekülen, um der Erkennung durch Antikörper oder T-Zellen zu entgehen (z.B. Influenza-Virus, HIV).
Immunsuppression: Aktive Hemmung oder Manipulation der Immunantwort des Wirts (z.B. Produktion von Molekülen, die Immunzellen lahmlegen).
Latenz/Verstecken: Rückzug in bestimmte Zellen oder Gewebe, wo das Immunsystem nur schwer hinkommt, und Verharren in einem inaktiven Zustand (z.B. Herpesviren).
Interferenz mit Signalwegen: Blockade oder Umleitung von Signalkaskaden innerhalb der Wirtszellen, die normalerweise zur Aktivierung der Immunabwehr führen.
Mimikry: Nachahmung von Wirtsmolekülen, um vom Immunsystem als "körpereigen" toleriert zu werden.
Wie passen nun all diese Fäden – die tiefe evolutionäre Geschichte, das Erbe der Neandertaler, die Macht des Mikrobioms und der Druck durch Pathogene – zusammen, um unsere heutige Immunlandschaft und ihre Anfälligkeiten zu erklären? Eine besonders spannende Frage ist, wie die an alte eurasische Bedingungen angepassten Neandertaler-Immunallele in unserer modernen Welt funktionieren, in der wir ganz anderen Mikroben ausgesetzt sind und einen völlig anderen Lebensstil pflegen. Könnte hier ein Schlüssel zum Verständnis des rasanten Anstiegs von Allergien und Autoimmunerkrankungen in Industrieländern liegen? Die berühmte „Hygiene-Hypothese“ versuchte dies ursprünglich mit einem Mangel an frühen Infektionen zu erklären. Sie wurde aber zur „Old Friends“-Hypothese weiterentwickelt. Diese besagt, dass uns heute nicht unbedingt die Infektionen fehlen, sondern der Kontakt zu den Mikroorganismen, mit denen wir uns über lange Zeit gemeinsam entwickelt haben – unsere „alten Freunde“ aus der Umwelt und unsere kommensalen Mitbewohner. Dieser Mangel an Exposition, besonders in der frühen Kindheit (weniger Kontakt mit Natur, übertriebene Hygiene in bestimmten Bereichen, veränderte Ernährung, Kaiserschnitte, Antibiotika), führt dazu, dass unser Immunsystem nicht mehr richtig „trainiert“ wird, seine regulatorischen Fähigkeiten (insbesondere die Toleranzentwicklung) nicht voll entfalten kann und daher zu überschießenden Reaktionen neigt.
Könnte es also sein, dass der „Mismatch“ der archaischen Neandertaler-Allele (die vielleicht zu stärkeren Entzündungsreaktionen neigen) durch das Fehlen der immunregulierenden Signale unserer „alten Freunde“ noch verschärft wird? Ein Immunsystem, das genetisch etwas „schärfer“ eingestellt ist, gerät möglicherweise leichter aus dem Ruder, wenn das mikrobielle Training zur Selbstkontrolle fehlt. Das ist eine faszinierende Vorstellung, die erklären könnte, warum gerade in modernen Gesellschaften, wo wir einerseits das Neandertaler-Erbe in uns tragen und andererseits den Kontakt zu unserer mikrobiellen Vergangenheit weitgehend verloren haben, chronisch-entzündliche Erkrankungen so stark zunehmen. Was denkst du über dieses komplexe Zusammenspiel aus alter DNA, modernen Lebensbedingungen und unseren mikrobiellen Partnern? Ist das eine plausible Erklärung für die Immun-Herausforderungen unserer Zeit? Lass uns gerne deine Gedanken dazu in den Kommentaren wissen – und wenn dich diese Reise durch die Evolution unseres Immunsystems genauso fasziniert hat wie mich, dann freue ich mich über ein Like für diesen Beitrag!
Vergleich: Hygiene-Hypothese vs. Old Friends-Hypothese
Merkmal | Hygiene-Hypothese (Ursprünglich) | Old Friends-Hypothese (Weiterentwicklung) |
Fokus | Mangel an Infektionskrankheiten in der frühen Kindheit | Mangel an Exposition gegenüber koevolvierten Mikroorganismen (Kommensalen, Umweltmikroben, evtl. Würmer) |
Mechanismus | Ungleichgewicht zw. Th1/Th2-Immunantworten (Unterforderung) | Unzureichende Entwicklung/Stimulation immunregulatorischer Mechanismen (v.a. Tregs, Toleranz) |
Ursache | Verbesserte Hygiene, weniger Geschwister, Impfungen | Urbanisierung, westl. Ernährung, Antibiotika, Kaiserschnitt, Verlust d. Kontakts zur Natur/Tieren |
Konsequenz | Erhöhtes Risiko für Allergien (später auch Autoimmunität erwähnt) | Erhöhtes Risiko für breites Spektrum chronisch-entzündlicher Erkrankungen (Allergien, Autoimmun., IBD) |
Implikation | Nicht: absichtlich Infektionen aussetzen | Wichtig: Wiederherstellung des Kontakts mit immunregulierenden Mikroben (Ernährung, Lebensstil etc.) |
Die Geschichte unseres Immunsystems ist also eine unglaublich vielschichtige Erzählung. Sie reicht von den fundamentalen Abwehrmechanismen der ersten Lebensformen über die revolutionäre Entwicklung der adaptiven Immunität bis hin zu den überraschenden genetischen Beiträgen unserer ausgestorbenen Verwandten und der tiefgreifenden, lebenslangen Partnerschaft mit unserem Mikrobiom. All das wurde und wird ständig durch das Wettrüsten mit Krankheitserregern geformt. Unser heutiges Immunsystem ist das Resultat dieses komplexen Zusammenspiels – ein dynamisches Erbe unserer tiefen Vergangenheit, geformt durch Gene, Mikroben und Widersacher. Die Erkenntnis, dass archaische Genvarianten und der Verlust des Kontakts zu unseren „alten mikrobiellen Freunden“ möglicherweise zum Anstieg moderner Immunerkrankungen beitragen, eröffnet völlig neue Perspektiven auf Gesundheit und Krankheit. Es zeigt, wie wichtig eine integrierte Sichtweise ist, die Genetik, Mikrobiologie, Ökologie und Evolution verbindet. Dieses Wissen kann uns helfen, individuelle Krankheitsrisiken besser zu verstehen und vielleicht sogar neue Therapieansätze zu entwickeln, die auf der Modulation des Mikrobioms oder der Berücksichtigung unseres einzigartigen evolutionären Erbes basieren. Die Evolution unseres Immunsystems ist noch lange nicht zu Ende – es passt sich weiter an neue Viren, veränderte Lebensweisen und globale Herausforderungen an. Seine Geschichte zu verstehen, ist der Schlüssel, um seine Gegenwart zu meistern und seine Zukunft mitzugestalten.
#Immunsystem #Evolution #Neandertaler #Mikrobiom #AdaptiveImmunität #AngeboreneImmunität #Koevolution #OldFriendsHypothese #Wissenschaft #Biologie
Bleib neugierig und entdecke mit uns weiter die Wunder der Wissenschaft! Folge uns für mehr spannende Einblicke und Diskussionen auch auf unseren Social-Media-Kanälen:
Verwendete Quellen:
Evolution der Immunsysteme der Wirbeltiere - https://www.mpg.de/8847152/mpiib_jb_2014
Evolutionary Immunology - News-Medical.net - https://www.news-medical.net/health/Evolutionary-Immunology.aspx
Evolution of Innate Immunity: Clues from Invertebrates via ... - Frontiers - https://www.frontiersin.org/journals/immunology/articles/10.3389/fimmu.2014.00459/full
Immune system - Evolution, Defense, Adaptation | Britannica - https://www.britannica.com/science/immune-system/Evolution-of-the-immune-system
Evolution of the Immune System | Veterian Key - https://veteriankey.com/evolution-of-the-immune-system/
Evolution and immunity - PMC - https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2913256/
Immune system - Wikipedia - https://en.wikipedia.org/wiki/Immune_system
Origin and evolution of the adaptive immune system: genetic events ... - PMC - https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3805090/
Neandertaler-Gene stärkten das Immunsystem moderner Menschen - https://www.mpg.de/9819624/neandertaler-gene-immunsystem
The Contribution of Neanderthal Introgression to Modern Human ... - PMC - https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9741939/
The contribution of Neanderthal introgression to modern human traits - PubMed - https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36167050/
Neanderthals boosted our immune system - Max-Planck-Gesellschaft - https://www.mpg.de/9819763/neanderthal-genes-immune-system
Role of the Microbiota in Immunity and inflammation - PMC - PubMed Central - https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4056765/
The role of gut microbiota in immune homeostasis and autoimmunity - PMC - https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3337124/
The gut microbiome and the immune system - Open Exploration Publishing - https://www.explorationpub.com/Journals/em/Article/100187
Aspects of Gut Microbiota and Immune System Interactions in Infectious Diseases, Immunopathology, and Cancer - Frontiers - https://www.frontiersin.org/journals/immunology/articles/10.3389/fimmu.2018.01830/full
Immune System Modulations by Products of the Gut Microbiota - MDPI - https://www.mdpi.com/2076-393X/8/3/461
Coevolutionary Immune System Dynamics Driving Pathogen Speciation - PMC - https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4108359/
Disrupted human–pathogen co-evolution: a model for disease - PMC - https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4142859/
Host-Pathogen Coevolution and the Emergence of Broadly Neutralizing Antibodies in Chronic Infections - PMC - PubMed Central - https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4956326/
Pathogen evolution and the immunological niche - PMC - https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4141700/
Impact of Historic Migrations and Evolutionary Processes on Human ... - PMC - https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7106516/
The Hygiene Hypothesis–Learning From but Not Living in the Past - Frontiers - https://www.frontiersin.org/journals/immunology/articles/10.3389/fimmu.2021.635935/full
How Our Ancient Origins Are Guiding Modern Medicine | NOVA | PBS - https://www.pbs.org/wgbh/nova/article/neanderthal-immune-system/
Evidence that RNA viruses drove of adaptive introgression between ... - PMC - https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6176737/
A signature of Neanderthal introgression on molecular mechanisms of environmental responses - PMC - PubMed Central - https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8509894/
Denisovan introgression has shaped the immune system of present ... - PMC - https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9731433/
Detection of Neanderthal Adaptively Introgressed Genetic Variants That Modulate Reporter Gene Expression in Human Immune Cells | Molecular Biology and Evolution | Oxford Academic - https://academic.oup.com/mbe/article/39/1/msab304/6400258
Endometriosis - on the intersection of modern environmental pollutants and ancient genetic regulatory variants | medRxiv - https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2025.04.15.25324328v1.full-text
Microbial 'Old Friends', immunoregulation and stress resilience - Oxford Academic - https://academic.oup.com/emph/article/2013/1/46/1858882














































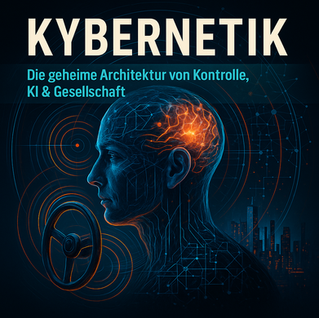

















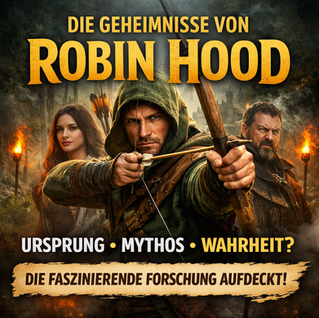





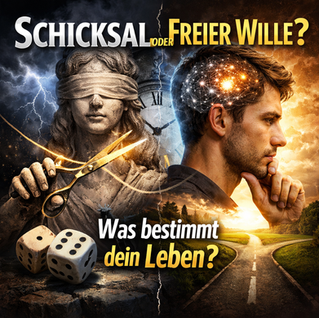




































Kommentare