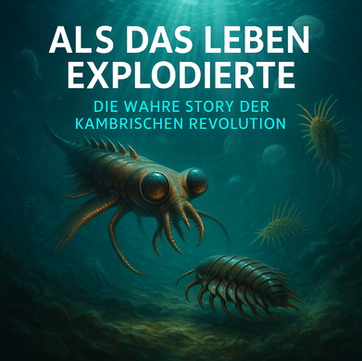Das Anthropozän ist ein informeller geologischer Begriff, der ein vorgeschlagenes neues Erdzeitalter beschreibt, in dem der Mensch zur dominanten geologischen Kraft auf der Erde geworden ist. Der Begriff wurde maßgeblich vom Atmosphärenchemiker Paul J. Crutzen und dem Biologen Eugene F. Stoermer im Jahr 2000 populär gemacht. Sie argumentierten, dass die menschlichen Aktivitäten, insbesondere seit der Industriellen Revolution, so tiefgreifende und globale Auswirkungen auf die Erdsysteme haben, dass sie eine neue Epoche in der Erdgeschichte rechtfertigen. Diese Auswirkungen umfassen Veränderungen der Atmosphäre, der Ozeane, der Landmassen und der Biodiversität, die in den geologischen Aufzeichnungen der Zukunft sichtbar sein werden.
Die Kernidee des Anthropozäns ist, dass menschliche Aktivitäten nicht länger nur lokale oder regionale Phänomene sind, sondern globale geologische Prozesse im Maßstab und in der Intensität beeinflussen, die mit natürlichen Kräften vergleichbar sind. Zu den Beweisen für diesen Einfluss gehören die rapide Zunahme der Treibhausgaskonzentrationen in der Atmosphäre, die Versauerung der Ozeane, der massive Verlust an Biodiversität und das Aussterben von Arten, die Umgestaltung der Landoberflächen durch Landwirtschaft und Urbanisierung sowie die weite Verbreitung von neuartigen Materialien wie Kunststoffen, Beton und Aluminium. Diese Materialien, oft als "Technofossilien" bezeichnet, hinterlassen eine dauerhafte Signatur in den Sedimenten und Gesteinen. Auch die globale Verteilung von Stickstoff und Phosphor durch Düngemittel hat den biogeochemischen Kreislauf des Planeten grundlegend verändert.
Trotz seiner weiten Verbreitung in der Wissenschaft und Öffentlichkeit ist das Anthropozän noch kein offiziell anerkannter Begriff in der Internationalen Stratigraphischen Tabelle. Die Anthropocene Working Group (AWG) der International Commission on Stratigraphy (ICS) untersucht seit vielen Jahren die Beweise und diskutiert die Kriterien für eine formale Anerkennung. Eine der Hauptdebatten dreht sich um die Definition des Beginns dieser neuen Epoche, den sogenannten Global Boundary Stratotype Section and Point (GSSP), oft als "Goldener Nagel" bezeichnet. Die Herausforderung besteht darin, ein klares, global synchrones Signal in den geologischen Aufzeichnungen zu finden, das den Übergang vom Holozän zum Anthropozän markiert.
Es gibt mehrere vorgeschlagene Startpunkte für das Anthropozän. Einige Forscher argumentieren für einen frühen Beginn mit der Entwicklung der Landwirtschaft und der damit verbundenen Entwaldung vor Tausenden von Jahren, die bereits zu signifikanten Veränderungen der atmosphärendichten Gase führte. Andere favorisieren den Beginn der Industriellen Revolution im späten 18. Jahrhundert, gekennzeichnet durch die massive Nutzung fossiler Brennstoffe und die Freisetzung von Kohlendioxid. Die AWG tendiert jedoch stark zu einem Beginn um die Mitte des 20. Jahrhunderts, einer Periode, die als "Große Beschleunigung" bekannt ist. In dieser Zeit nahmen viele Indikatoren des menschlichen Einflusses – wie Bevölkerungswachstum, Energieverbrauch, Urbanisierung und die Produktion von Kunststoffen – exponentiell zu. Ein spezifischer Marker für diesen Zeitpunkt ist der weltweite Fallout von Radionukliden aus Atomwaffentests, der eine global nachweisbare Schicht in Sedimenten und Eisbohrkernen hinterlassen hat.
Das Konzept des Anthropozäns ist jedoch mehr als nur eine geologische Klassifikation; es ist auch ein kraftvolles Rahmenwerk für das Verständnis der tiefgreifenden und oft irreversiblen Auswirkungen menschlicher Aktivitäten auf das Erdsystem. Es zwingt die Menschheit dazu, ihre Rolle als planetare Kraft zu erkennen und die Verantwortung für die Gestaltung ihrer eigenen Zukunft zu übernehmen. Das Anthropozän wirft fundamentale Fragen nach Nachhaltigkeit, Ethik und der Beziehung zwischen Mensch und Natur auf und hat weitreichende Implikationen für Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, da es die Notwendigkeit globaler Zusammenarbeit zur Bewältigung der Herausforderungen des Klimawandels, des Artensterbens und der Ressourcenknappheit unterstreicht.