Vom Groschenheft zum globalen Mythos – wie Superhelden als Spiegel unserer Zeit funktionieren
- Benjamin Metzig
- 24. Nov. 2025
- 10 Min. Lesezeit

Cape, Krise, Kinohit: Die heimliche Kulturgeschichte der Superhelden als Spiegel der Gesellschaft
Stell dir vor, ein Kulturhistoriker, ein Politikwissenschaftler und ein Teenager mit Popcorn sitzen gemeinsam im Kino. Auf der Leinwand fliegt ein Mann im Cape über New York, im Hintergrund explodiert irgendwas, im Vordergrund wird über Verantwortung, Macht und Schuld diskutiert. Wer hat jetzt recht: der Teenager, der einfach “cooler Film!” sagt – oder die anderen beiden, die darin einen Kommentar zu Kapitalismus, Krieg oder Überwachung sehen?
Die Antwort ist: alle. Superhelden sind gleichzeitig Spektakel und seelischer Seismograph. Sie messen, was eine Gesellschaft fühlt: Angst, Hoffnung, Wut, Sehnsucht. Sie sind Superhelden als Spiegel – und genau das macht sie so faszinierend.
Wenn du Lust auf mehr solcher tiefen, nerdigen, aber gut verdaulichen Tauchgänge in Popkultur und Wissenschaft hast, abonniere gern meinen monatlichen Newsletter – dort gibt es regelmäßig neue Analysen, Hintergründe und Leseempfehlungen.
In diesem Beitrag reisen wir von antiken Halbgöttern über viktorianische Groschenhefte, Pulp-Magazine und Comic-Zensur bis zum Marvel Cinematic Universe und zur aktuellen “Superhero Fatigue”. Und wir fragen immer wieder: Was erzählen uns diese Figuren eigentlich über uns?
Von Halbgöttern zu Groschenheften: Die lange Vorgeschichte des Superhelden
Der moderne Superheld wirkt wie ein Produkt des 20. Jahrhunderts: bunte Kostüme, Geheimidentität, Logo auf der Brust. Aber seine Bausteine sind sehr viel älter. Schon das Gilgamesch-Epos oder die Taten des Herkules erzählen von übermenschlichen Gestalten, die irgendwo zwischen Mensch und Gott hängen, mit großer Macht und mindestens genauso großen psychischen Problemen.
Richtig spannend wird es, als im 19. Jahrhundert die Alphabetisierung rasant zunimmt und plötzlich billige Unterhaltung für die Massen entsteht. In Großbritannien heißen die Hefte Penny Dreadfuls, in den USA Dime Novels. Sie kosten wenig, sind schnell produziert und liefern Serienfiguren, die immer wiederkehren: Cowboys, Detektive, Abenteuerhelden.
Figuren wie Nick Carter überbrücken die Lücke zwischen Realismus und Fantastik. Gleichzeitig wird ein Trend geboren, der uns heute völlig selbstverständlich erscheint: reale Personen werden zu Marken. Buffalo Bill Cody wird nicht nur erzählt, er wird vermarktet: Spielzeug, Geschirr, Shows. Das ist, streng genommen, das Urmodell dessen, was Marvel heute mit The Avengers macht. Nur ohne Funko-Pop-Regal.
Schon hier funktionieren Superhelden als Spiegel: Die Geschichten projizieren die Träume einer industrialisierten Gesellschaft, die von Weite, Abenteuer und klaren Heldenfiguren träumt – während die reale Welt immer komplexer und anonymer wird.
Geheimidentität und Maske: Warum wir den doppelten Menschen brauchen
Der nächste große Evolutionssprung passiert auf der Bühne und im Romanregal. Mit The Scarlet Pimpernel (1903) etabliert Baroness Orczy das Prinzip der Doppelidentität in Reinform: ein scheinbar nutzloser Aristokrat, der heimlich als maskierter Retter Leben riskiert. Am Tag Dandy, in der Nacht Held.
Dieses Muster kennen wir heute auswendig: Bruce Wayne / Batman, Clark Kent / Superman, Don Diego / Zorro. Die Maske dient nicht nur dem Schutz der Liebsten – sie trennt zwei widersprüchliche Rollen, die in einer modernen Gesellschaft kaum vereinbar scheinen: angepasst vs. rebellisch, pflichtbewusst vs. radikal gerechtigkeitsbesessen.
Interessanterweise findet man ähnliche Motive schon in amerikanischen Shakespeare-Inszenierungen des 19. Jahrhunderts: Männer in Strumpfhosen, theatralische Kämpfe, Verkleidungen, geheime Identitäten. Die kulturelle Akzeptanz für Menschen in Kostümen war also längst da, bevor jemand auf die Idee kam, ein großes “S” auf die Brust zu malen.
Hier wird zum ersten Mal sichtbar, was Superhelden als Spiegel konkret bedeutet: Die Figuren verhandeln unsere gespaltene Identität zwischen öffentlicher Rolle und innerem Anspruch. Wer sind wir, wenn niemand zuschaut – und wer würden wir gern sein?
Pulp-Helden: Schatten, Bronze und der Weg zu Superman & Batman
In den 1930er Jahren landen all diese Motive in den Pulp-Magazinen – billigen Heften auf grobem Papier. Zwei Figuren sind quasi die direkten Eltern des Superhelden:
The Shadow, ein düsterer Vigilant, der mit Angst, Tarnung und “clouding men’s minds” arbeitet. Seine Nähe zu Batman ist so stark, dass die erste Batman-Story praktisch eine Shadow-Handlung remixt.
Doc Savage, der “Mann aus Bronze”, verkörpert den wissenschaftlich optimierten Übermenschen: trainiert, genial, mit einer Festung in der Arktis – ein Konzept, das Superman später fast 1:1 übernimmt.
Dazu kommt Philip Wylies Roman Gladiator, in dem der Protagonist Hugo Danner durch ein Serum kugelsicher und überstark wird, aber tragisch daran scheitert, seinen Platz in der Menschheit zu finden. Körperlich ist er ein Vorläufer Supermans, psychologisch ein Kommentar auf die Einsamkeit des Überbegabten.
Diese Pulp-Phase zeigt, wie sehr Superhelden als Spiegel von Technik- und Fortschrittsglauben funktionieren. Die Botschaft: Wenn wir Wissenschaft und Training auf die Spitze treiben, können wir Übermenschen werden – aber emotional bleiben wir tief verletzlich.
Das Goldene Zeitalter: Superman, Krieg und die Erfindung eines neuen Mythos
Mit Action Comics #1 (1938) beginnt das Goldene Zeitalter der Comics. Superman ist nicht einfach ein starker Typ im Cape; er ist das Produkt sehr konkreter Erfahrungen. Seine Schöpfer Jerry Siegel und Joe Shuster sind jüdische Teenager, Kinder von Einwanderern, geprägt von Antisemitismus und wirtschaftlicher Unsicherheit.
Kal-El wird von einer sterbenden Welt auf eine neue geschickt, muss sich anpassen, versteckt sich als unscheinbarer Reporter – und setzt seine Kräfte ein, um Unterdrückte zu schützen. Im Subtext ist Superman eher golemartige Schutzfigur und sozialer Reformer als strahlender Nationalheld. Erst der Zweite Weltkrieg verschiebt den Fokus stärker auf Patriotismus.
Während des Krieges werden Superhelden zu Propaganda-Ikonen. Captain America verpasst Hitler schon auf dem Cover seiner ersten Ausgabe einen Faustschlag, noch bevor die USA offiziell im Krieg sind. Superman, Batman & Co. verkaufen Kriegsanleihen, bekämpfen Saboteure, verteidigen den “American Way”. Die Helden sind jetzt nicht nur individuelle Fantasien, sondern nationale Projektionsflächen.
Eine radikale Gegenfigur ist Wonder Woman. William Moulton Marston entwirft sie als feministischen Gegenentwurf zu männlichen Machtfantasien – und gleichzeitig sind die Comics voller Fesselungsbilder, Unterwerfungs- und Befreiungsszenen. Zwischen Emanzipation und Fetisch läuft eine bis heute diskutierte Spannung. Aber eines ist klar: Wonder Woman beweist früh, dass eine Frau ein eigenes Franchise tragen kann, lange bevor Hollywood dafür bereit war.
Superhelden sind in dieser Phase vor allem Spiegel nationaler Identität: Wer gehört dazu? Wer wird beschützt? Und welche Werte sind es wert, dafür in den Krieg zu ziehen?
Radio, Zensur und die unsichtbaren Grenzen der Fantasie
Nicht nur Comics, auch das Radio prägt die Superhelden-Mythologie. Die Hörspielserie The Adventures of Superman erfindet zentrale Elemente wie Kryptonit oder die Figur Jimmy Olsen. Legendär ist die Storyline “Clan of the Fiery Cross”, in der Superman den Ku-Klux-Klan demütigt – basierend auf echten, geleakten Ritualen. Der Effekt: Ein rassistischer Geheimbund wird zum Witz in einer Kindersendung. Popkultur als Waffe gegen Hass.
Doch in den 1950ern kippt die Stimmung. Horror- und Crime-Comics sorgen für eine moralische Panik. Der Psychiater Fredric Wertham behauptet, Comics würden Jugendliche verderben und deutet Batman & Robin als schwule Fantasie, Wonder Woman als lesbisches Vorbild. Senatsanhörungen, öffentliche Comic-Verbrennungen – am Ende installiert die Industrie die Comics Code Authority, eine strenge Selbstzensur.
Was bedeutet das konkret?
keine Zombies, Vampire oder explizite Gewalt
Autoritätspersonen dürfen nicht negativ dargestellt werden
“sexuelle Abnormitäten” sind tabu – was praktisch jedes queere Andeuten ausradierte
Das Ergebnis: Superhelden werden weichgespült. Statt gesellschaftlicher Konflikte gibt es alberne Sci-Fi-Storys mit Zeitreisen, Aliens und absurden Superkräften. Fantasie ja – aber bitte ohne echte Gefühle.
Auch hier wirken Superhelden als Spiegel: Sie zeigen, wie sehr eine Gesellschaft versucht, unbequeme Themen wegzudrücken, wenn sie Angst um ihre Jugend oder ihre Normen hat.
Silbernes und Bronzenes Zeitalter: Wissenschaft, Neurosen und soziale Relevanz
Mitte der 1950er beginnt die Reanimation des Genres. Ein neuer Flash und eine sci-fi-lastige Green Lantern holen Atomangst und Raumfahrt direkt ins Superheldenuniversum. Die Kräfte kommen jetzt nicht mehr aus Magie, sondern aus Radioaktivität, kosmischer Strahlung und außerirdischer Technologie. Fortschrittsoptimismus und kalter Krieg treffen sich im Cape.
Die eigentliche Revolution passiert aber bei Marvel. Stan Lee, Jack Kirby und Steve Ditko entwerfen Helden, die sich nicht wie Götter, sondern wie Menschen anfühlen:
Die Fantastic Four streiten, sind eitel, verängstigt, manchmal schlicht nervig.
Spider-Man ist ein Teenager, der Mobbing, Geldsorgen und Liebesdrama hat – plus Spinnensinn.
Die X-Men werden zu einer Allegorie für Minderheiten, die “gehasst und gefürchtet” sind, weil sie anders geboren wurden.
Parallel dazu beginnt das Bronzene Zeitalter, in dem Superhelden sich den dunklen Seiten der Gesellschaft stellen. Drogenabhängigkeit, Rassismus, Korruption – plötzlich ist all das Thema. Marvel bricht offen mit dem Comics Code, indem es Drogenkonsum in Spider-Man zeigt, nicht als coolen Trip, sondern als zerstörerische Realität. DC zieht mit der berühmten Geschichte nach, in der Green Arrows Sidekick Speedy heroinabhängig ist.
Der Schockmoment schlechthin: Der Tod von Gwen Stacy (1973). Spider-Man versucht, seine Freundin zu retten – und tötet sie möglicherweise durch seinen eigenen Rettungsversuch. Die Botschaft: Auch Helden können scheitern, und ihre Fehler haben endgültige Konsequenzen.
In diesen Jahrzehnten werden Superhelden als Spiegel besonders scharfkantig. Sie erzählen nicht mehr nur, wie wir gern wären, sondern auch, wovor wir uns fürchten – in uns selbst und in unseren Institutionen.
Deutschland zwischen Asterix und Superman: Der Fall Rolf Kauka
Während in den USA Marvel und DC immer politischer werden, erlebt Deutschland eine ganz eigene Episode: Verleger Rolf Kauka kauft Lizenzen für Asterix, Superman und andere Comics – und “eindeutscht” sie radikal. Aus Asterix wird “Siggi”, aus gallischem Widerstand ein nationalistischer, antikommunistischer Diskurs, der die Römer als Besatzungsmacht codiert. Auch Superman bekommt ideologisch und inhaltlich veränderte Abenteuer.
Hier zeigt sich, wie leicht Superhelden-Narrative zur Projektionsfläche politischer Agenda werden. Die Figuren sind so stark mit Symbolik aufgeladen, dass man sie relativ einfach umcodieren kann – und damit die Wahrnehmung von Heldentum, Feindbildern und Geschichtsbildern beeinflusst. Superhelden sind nicht nur Spiegel, sie können auch Zerrspiegel sein.
Dark Age & Dekonstruktion: Wenn der Held selbst zum Problem wird
Die 1980er bringen einen Bruch, der bis heute nachwirkt. Mit Watchmen und The Dark Knight Returns wird der Superheld auseinandergenommen wie ein Motor im Physikunterricht.
In Watchmen sind die Kostümträger keine moralischen Leuchttürme, sondern Menschen mit Traumata, Ideologien und Abgründen. Dr. Manhattan verliert das Interesse an der Menschheit, Rorschach radikalisiert sich bis zum Extremismus. Die Frage ist nicht mehr “Wer rettet uns?”, sondern “Wer schützt uns vor denen, die glauben, uns retten zu dürfen?”.
Frank Millers Batman ist in The Dark Knight Returns ein älterer, brutaler Vigilant, der von Staat und Medien gehasst, aber von Teilen der Bevölkerung gefeiert wird. Superman wird zur Regierungswaffe. Heldentum erscheint hier als gefährliche Obsession, als Grenzüberschreitung.
Die British Invasion (Neil Gaiman, Grant Morrison, Garth Ennis u.a.) vertieft diese Richtung. Mit dem Vertigo-Imprint entstehen Serien, die Superhelden-Elemente mit Horror, Philosophie und Literatur verweben. Die Botschaft: Comics sind kein Kinderkram, sondern ein Medium, in dem man genauso komplex erzählen kann wie in Romanen – nur mit mehr Dämonen und Lederjacken.
Parallel gründet sich Image Comics, Superstar-Künstler übernehmen die Kontrolle, die Spekulationsblase der 1990er bläht den Markt auf, bis er kollabiert. Marvel geht pleite, verkauft Filmrechte – ironischerweise der erste Schritt hin zum späteren Milliarden-Franchise.
Vom Bankrott zum Blockbuster: Kino, MCU und globale Mythologie
Spätestens mit Blade (1998), X-Men (2000) und Spider-Man (2002) wird klar: Superhelden sind im Kino angekommen, und sie bleiben. Nach 9/11 verändert sich die Tonlage. The Dark Knight verhandelt Überwachung und Terrorismus, Captain America: The Winter Soldier fragt, wann Sicherheit in autoritäre Kontrolle kippt.
Mit Iron Man (2008) startet das Marvel Cinematic Universe ein Experiment in serieller Langzeiterzählung: einzelne Filme, die zusammen eine große, verschachtelte Story bilden, mit Crossovers, Endcredit-Szenen und Eventfilmen. Hollywood lernt plötzlich, in “Phasen” zu denken wie ein Comicverlag.
Dabei zeigt sich die Vielseitigkeit des Genres:
Guardians of the Galaxy als Space Opera
Ant-Man als Heist-Movie
Black Panther als afrofuturistische Utopie und Kolonialismuskritik
Wonder Woman als feministischer Kriegsfilm
Superhelden sind nicht länger nur ein Genre, sie sind eine Art Container, in den man fast jede Erzählform packen kann. Und sie sind global: Figuren, die einst auf billigem Holzzellstoffpapier entstanden, sind heute identitätsstiftende Ikonen von São Paulo bis Seoul.
Wenn dir dieser Blick hinter die Kulissen der Popkultur gefällt, lass dem Beitrag gern ein Like da und schreib in die Kommentare, welcher Superheld oder Antiheld dich persönlich am meisten geprägt hat – und warum.
Gegenwart: Superheldenmüdigkeit, böse Supermen und die Frage nach der Rekonstruktion
In den 2020ern zeigt sich allerdings eine neue Ermüdung. Nach dem gigantischen Höhepunkt von Avengers: Endgame wirkt vieles wie Nachspiel: zu viele Serien, zu viele mittelmäßige Effekte, zu wenig klarer erzählerischer Kurs. Gleichzeitig boomt ein Subgenre: der “böse Superman”.
Homelander (The Boys), Omni-Man (Invincible), Injustice-Superman und Co. drehen das ursprüngliche Versprechen von Superman um: Was, wenn der mächtigste Mensch der Welt nicht gut ist? Wenn Konzerne und Staaten ihn instrumentalisieren? Diese Figuren sind Personifikationen eines tiefen Misstrauens gegenüber Institutionen, Eliten und “Rettern”, die zu viel Macht anhäufen.
Streamingplattformen verstärken diesen Trend. Einerseits ermöglichen sie mutige Experimente wie WandaVision, andererseits erzeugen sie einen Content-Dauerlauf, der die Marke “Superheld” ausdünnt. Viele Fans sprechen von “Superhero Fatigue”, und die Kinokassen geben ihnen manchmal recht.
Aber das bedeutet nicht, dass der Mythos verschwindet. Im Gegenteil: Er steht vor seiner nächsten Metamorphose. Nach der Konstruktion (Goldenes Zeitalter) und der Dekonstruktion (Dark Age) steht jetzt die Rekonstruktion an. Wie kann Heldentum im 21. Jahrhundert aussehen, ohne naiv zu sein – aber auch ohne im Dauerzynismus zu versacken?
Vielleicht werden künftige Held*innen weniger Übermenschen und mehr verletzliche, fehlerhafte Figuren sein, die trotzdem Verantwortung übernehmen. Vielleicht werden Themen wie Klimakrise, KI oder soziale Ungleichheit stärker in den Mittelpunkt rücken. Sicher ist: Solange eine Lücke besteht zwischen der Welt, wie sie ist, und der Welt, wie sie sein könnte, werden wir Geschichten von Menschen erzählen, die versuchen, diese Lücke zu überbrücken.
Superhelden bleiben damit, was sie von Anfang an waren: Superhelden als Spiegel unserer Hoffnungen, Ängste und Widersprüche – mal auf billigem Papier, mal als milliardenschwere Franchise-Maschine.
Wenn du Lust hast, diese Entwicklung weiter mitzuverfolgen, komm gern in die Wissenschaftswelle-Community:
👉 Instagram: https://www.instagram.com/wissenschaftswelle.de/
👉 Facebook: https://www.facebook.com/Wissenschaftswelle
Folge den Kanälen für weitere Deep Dives in die Welt zwischen Popkultur und Wissenschaft – und vergiss nicht, den Artikel zu liken und deine Gedanken unten in den Kommentaren zu teilen. Welche Phase der Superheldengeschichte findest du am spannendsten – und warum?
Quellen:
Prehistory of the Superhero (Part 6): The Fabulous Junkshop – https://www.hoodedutilitarian.com/2013/10/prehistory-of-the-superhero-part-6-the-fabulous-junkshop/
History of American comics – https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_American_comics
Precursors to Superheroes – https://www.youtube.com/watch?v=BJ11ESED8VI
Secret identity – https://en.wikipedia.org/wiki/Secret_identity
Secret Identities and the Gothic: That Demmed, Elusive Pimpernel – https://www.blackgate.com/2013/04/18/secret-identities-and-the-gothic-that-demmed-elusive-pimpernel/
The Shadow – https://en.wikipedia.org/wiki/The_Shadow
Doc Savage, a Pulp Precursor to Comic Superhero's – https://comicbookhistorians.com/doc-savage-a-pulp-precursor-to-comic-superheros/
Superman Inspiration: Gladiator by Philip Wylie – https://nicksupes.com/2019/10/15/superman-inspiration-gladiator-by-philip-wylie/
Superman May Tell A Jewish Story — But It's Not The One You'd Expect – https://forward.com/culture/397860/superman-jewish-story-assimilation-not-exodus/
Golden Age of Comic Books – https://en.wikipedia.org/wiki/Golden_Age_of_Comic_Books
The Political Influence of Comics in America During WWII – https://www.nelson.edu/thoughthub/history/the-political-influence-of-comics-in-america-during-wwii/
Wonder Woman: A Story of Female Bondage or Liberation? – https://thejesuitpost.org/2017/06/wonder-woman-pro-woman-or-anti-woman/
A Review of Wonder Woman: Bondage and Feminism in the Marston/Peter Comics 1941–1948 – https://www.comicsgrid.com/article/3521/galley/5279/download/
Censorship and the Comics Code Authority – https://home.heinonline.org/blog/2025/10/censorship-and-the-comics-code-authority/
How the “Code Authority” Kept LGBT Characters Out of Comics – https://www.history.com/articles/how-the-code-authority-kept-lgbt-characters-out-of-comics
The Ultimate Guide to Comic Book Ages – https://www.sparklecitycomics.com/the-ultimate-guide-to-comic-book-ages/
Representation and Metaphors for Civil Rights in Marvel Comics – https://digitalcommons.library.uab.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1062&context=vulcan
Green Lantern/Green Arrow #85: Timeless Classic or A Classic For It's Time – https://dccomicsnews.com/2019/12/10/green-lantern-green-arrow-85-timeless-classic-or-a-classic-for-its-time/
The Night Gwen Stacy Died – https://en.wikipedia.org/wiki/The_Night_Gwen_Stacy_Died
British Invasion (comics) – https://en.wikipedia.org/wiki/British_Invasion_(comics)
Image Comics – https://en.wikipedia.org/wiki/Image_Comics
How Marvel Went From Bankruptcy to Billions – https://www.denofgeek.com/movies/how-marvel-went-from-bankruptcy-to-billions/
Superman (1978 film) – https://en.wikipedia.org/wiki/Superman_(1978_film)
How WB's Batman 1989 Tricks Completely Changed Movie Marketing Forever – https://screenrant.com/batman-1989-trailer-marketing-campaign-changed-movies/
How The First X-Men Movie Changed The Superhero Genre – https://www.denofgeek.com/movies/how-the-first-x-men-movie-changed-the-superhero-genre/
Afrofuturism and Black Panther – https://contexts.org/articles/afrofuturism-and-black-panther/
A Brief History of Women in Marvel & DC Comics – https://fanexpohq.com/fanexpocanada/deep-dive-a-brief-history-of-women-in-marvel-dc-comics/
The Future of The Superhero Genre – https://www.trashtalkreverse.com/post/future-of-superhero-genre
Irredeemable, Invincible, Injustice: How Deconstruction Desecrated the Sun God – https://comicbookclublive.com/2025/10/15/irredeemable-invincible-injustice-how-deconstruction-desecrated-the-sun-god/
Exposing 'Superhero Fatigue' – https://www.youtube.com/watch?v=scnt0La4gl0




























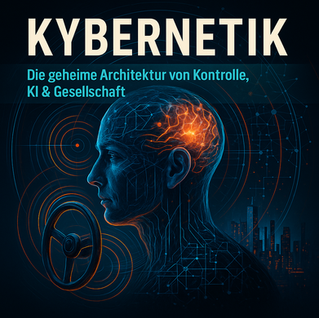

















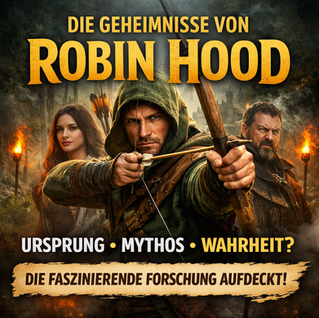





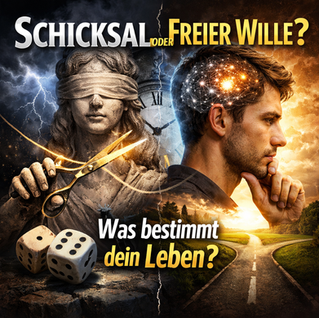









































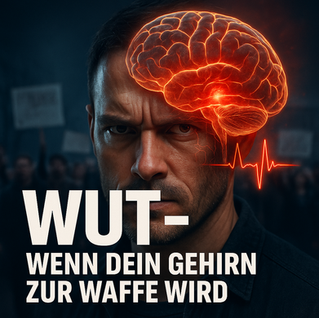












Kommentare