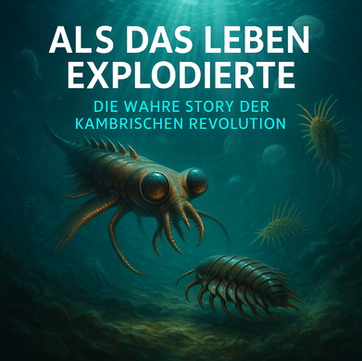Der Bahndrehimpuls, oft als Orbitaldrehimpuls bezeichnet, ist eine fundamentale physikalische Größe, die die Rotationsbewegung eines Objekts um einen festen Bezugspunkt beschreibt. In der klassischen Mechanik wird er als das Vektorprodukt aus dem Ortsvektor des Objekts und seinem Impulsvektor definiert: L = r × p, wobei r der Ortsvektor vom Ursprung zum Objekt und p der Impuls des Objekts ist. Seine Einheit ist Joule-Sekunde (J·s) oder Kilogramm mal Quadratmeter pro Sekunde (kg·m²/s). Der Bahndrehimpuls ist eine Erhaltungsgröße in Systemen, auf die kein äußeres Drehmoment wirkt. Dies bedeutet, dass in einem isolierten System der Gesamtdrehimpuls konstant bleibt, was weitreichende Konsequenzen für viele physikalische Phänomene hat, von der Bewegung der Planeten um die Sonne bis hin zur Rotationsgeschwindigkeit von Eisläufern.
Ein klassisches Beispiel für die Erhaltung des Bahndrehimpulses ist die Bewegung von Himmelskörpern. Gemäß den Keplerschen Gesetzen bewegen sich Planeten auf elliptischen Bahnen um die Sonne, und die Verbindungslinie zwischen Planet und Sonne überstreicht in gleichen Zeiten gleiche Flächen. Dies ist eine direkte Folge der Erhaltung des Bahndrehimpulses, da die Gravitationskraft der Sonne auf den Planeten ein zentrales Kraftfeld darstellt und somit kein Drehmoment auf den Planeten ausübt. Auch bei der Beschreibung von Satellitenbahnen oder der Dynamik von Galaxien spielt der Bahndrehimpuls eine entscheidende Rolle. Ohne die Berücksichtigung dieser Erhaltungsgröße wären viele astronomische Beobachtungen und Vorhersagen nicht möglich.
In der Quantenmechanik nimmt der Bahndrehimpuls eine noch speziellere und fundamentalere Bedeutung ein, insbesondere bei der Beschreibung von Elektronen in Atomen und Molekülen. Hier ist der Bahndrehimpuls nicht mehr eine kontinuierliche Größe, die jeden beliebigen Wert annehmen kann, sondern er ist quantisiert. Das bedeutet, er kann nur diskrete Werte annehmen. Diese Quantisierung ist eine direkte Konsequenz der Wellennatur der Materie und der Randbedingungen, die durch die Bindung der Elektronen an den Atomkern vorgegeben sind. Die mathematische Beschreibung des Bahndrehimpulses in der Quantenmechanik erfolgt über Operatoren, die auf die Wellenfunktion des Elektrons wirken.
Die Größe des Bahndrehimpulses eines Elektrons wird durch die Bahndrehimpulsquantenzahl, oft als l bezeichnet, bestimmt. Für ein gegebenes Hauptquantenzahl n kann l Werte von 0 bis n-1 annehmen. Die tatsächliche Größe des Betrags des Bahndrehimpulses ist gegeben durch |L| = ħ√(l(l+1)), wobei ħ (gesprochen "h-quer") das reduzierte Plancksche Wirkungsquantum ist. Jeder Wert von l entspricht einer bestimmten Form des Atomorbitals: l=0 für s-Orbitale (sphärisch), l=1 für p-Orbitale (hantelförmig), l=2 für d-Orbitale (komplexere Formen) und so weiter.
Neben der Größe des Bahndrehimpulses ist auch dessen Orientierung im Raum quantisiert. Dies wird durch die magnetische Quantenzahl m_l beschrieben. Für einen gegebenen Wert von l kann m_l alle ganzzahligen Werte von -l über 0 bis +l annehmen. Die magnetische Quantenzahl gibt die Projektion des Bahndrehimpulsvektors auf eine definierte Achse (konventionell die z-Achse) an: L_z = m_lħ. Dieses Phänomen wird als räumliche Quantisierung bezeichnet und führt dazu, dass der Bahndrehimpulsvektor nicht beliebig ausgerichtet sein kann, sondern nur bestimmte diskrete Winkel relativ zur z-Achse einnehmen darf. Dies ist experimentell beispielsweise im Zeeman-Effekt sichtbar, bei dem atomare Energieniveaus in einem externen Magnetfeld aufspalten.
Es ist wichtig, den Bahndrehimpuls vom Spin zu unterscheiden, einem intrinsischen Drehimpuls von Elementarteilchen, der nicht mit einer klassischen Bewegung im Raum assoziiert werden kann. Während der Bahndrehimpuls die Bewegung eines Teilchens um einen Punkt beschreibt, ist der Spin eine rein quantenmechanische Eigenschaft. Beide addieren sich zum Gesamtdrehimpuls eines Systems. Der Bahndrehimpuls ist entscheidend für das Verständnis der elektronischen Struktur von Atomen und Molekülen, die Spektrallinien, die chemischen Eigenschaften der Elemente und die Art und Weise, wie Atome Bindungen eingehen. Er bildet eine Säule der modernen Physik und Chemie und ist unerlässlich für die Entwicklung vieler Technologien, von Lasern bis zur Kernspinresonanz.