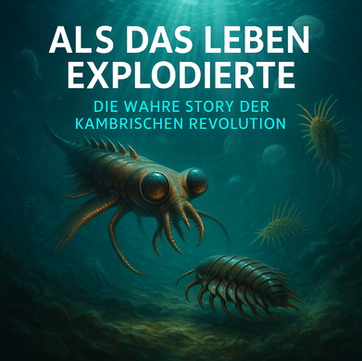Chiralität bezeichnet in der Chemie und Physik die Eigenschaft eines Objekts, mit seinem Spiegelbild nicht deckungsgleich zu sein. Das prominenteste und anschaulichste Beispiel hierfür sind unsere Hände: Die linke Hand ist das Spiegelbild der rechten Hand, kann aber durch keine Drehung oder Verschiebung vollständig mit ihr zur Deckung gebracht werden. Objekte, die diese Eigenschaft besitzen, werden als chiral bezeichnet, während Objekte, die mit ihrem Spiegelbild deckungsgleich sind, achiral genannt werden (z.B. ein Würfel oder eine Kugel).
Auf molekularer Ebene ist Chiralität von fundamentaler Bedeutung. Ein Molekül ist chiral, wenn es mindestens ein Chiralitätszentrum besitzt. Häufig ist dies ein Kohlenstoffatom, das an vier verschiedene Substituenten gebunden ist. Solche Moleküle existieren in zwei spiegelbildlichen Formen, die als Enantiomere bezeichnet werden. Diese Enantiomere verhalten sich zueinander wie die linke und rechte Hand: Sie sind nicht durch einfache Rotation zur Deckung zu bringen.
Enantiomere besitzen identische physikalische Eigenschaften wie Schmelzpunkt, Siedepunkt, Dichte und Löslichkeit. Sie unterscheiden sich jedoch in ihrer Wechselwirkung mit polarisiertem Licht; sie drehen die Ebene des linear polarisierten Lichts um den gleichen Betrag, aber in entgegengesetzte Richtungen (optische Aktivität). Dies ist der Grund, warum sie früher auch als optische Isomere bezeichnet wurden. Ihre chemischen Eigenschaften sind ebenfalls identisch, solange sie mit achiralen Reagenzien reagieren. Bei Reaktionen mit anderen chiralen Molekülen zeigen sie jedoch oft unterschiedliches Verhalten.
Die biologische Welt ist nahezu vollständig chiral. Proteine, Enzyme, Nukleinsäuren (DNA, RNA) und viele Zucker sind chirale Moleküle, die in der Regel nur in einer bestimmten Enantiomerenform vorkommen oder von biologischen Systemen bevorzugt erkannt werden. Beispielsweise können Enzyme aufgrund ihrer eigenen Chiralität nur spezifische Enantiomere als Substrat binden und umsetzen. Dies ist vergleichbar mit einem Handschuh, der nur auf die passende Hand passt.
Diese Spezifität ist besonders in der Pharmazie von entscheidender Bedeutung. Viele Medikamente sind chirale Moleküle, bei denen oft nur ein Enantiomer die gewünschte therapeutische Wirkung entfaltet, während das andere Enantiomer inaktiv sein oder sogar unerwünschte Nebenwirkungen hervorrufen kann. Ein bekanntes und tragisches Beispiel hierfür ist das Medikament Thalidomid (Contergan), bei dem ein Enantiomer als Beruhigungsmittel wirkte, das andere jedoch teratogene Effekte hatte. Daher ist die Entwicklung und Synthese von enantiomerenreinen Wirkstoffen ein wichtiges Forschungsfeld in der pharmazeutischen Chemie.
Neben Enantiomeren gibt es auch Diastereomere, die Stereoisomere sind, aber nicht spiegelbildlich zueinander. Sie unterscheiden sich in ihren physikalischen und chemischen Eigenschaften und können leichter voneinander getrennt werden als Enantiomere. Diastereomere entstehen, wenn ein Molekül mehr als ein Chiralitätszentrum besitzt und sich die Konfiguration an mindestens einem, aber nicht allen Chiralitätszentren unterscheidet.
Eine äquimolare Mischung zweier Enantiomere wird als Racemat bezeichnet. Racemate sind optisch inaktiv, da sich die Drehungen des polarisierten Lichts durch die beiden Enantiomere gegenseitig aufheben. Die Trennung von Racematen in ihre reinen Enantiomere, die sogenannte Racematspaltung, ist oft ein komplexer und aufwendiger Prozess, der für die Herstellung vieler moderner Medikamente unerlässlich ist.
Die Bestimmung der absoluten Konfiguration von chiralen Molekülen, also die exakte räumliche Anordnung der Substituenten um das Chiralitätszentrum, erfolgt oft über das Cahn-Ingold-Prelog-System (R/S-Nomenklatur) oder die Fischer-Projektion (D/L-Nomenklatur). Methoden zur Analyse und Trennung von chiralen Verbindungen umfassen die optische Rotationsdispersion (ORD), Zirkulardichroismus (CD), chirale Gaschromatographie und Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC) mit chiralen Säulen.