Geoengineering: Retten wir das Klima oder riskieren wir alles? Aktuelle Projekte auf dem Prüfstand
- Benjamin Metzig
- 23. Mai 2025
- 8 Min. Lesezeit

Wir stehen an einem Punkt, an dem die Menschheit nicht nur darüber nachdenkt, wie sie das Klima der Erde beeinflusst hat, sondern auch, wie sie es vielleicht gezielt verändern könnte, um die schlimmsten Folgen des Klimawandels abzumildern. Die Rede ist von Geoengineering – ein Begriff, der bei manchen sofort die Alarmglocken schrillen lässt und bei anderen visionäre Hoffnungen weckt. Ist es ein genialer Plan B, ein verzweifelter letzter Ausweg oder eine Büchse der Pandora, die wir lieber geschlossen halten sollten? Lasst uns gemeinsam eintauchen in dieses unglaublich spannende Feld, das von kühnen wissenschaftlichen Projekten bis hin zu hitzigen ethischen Debatten reicht. Schnallt euch an, es wird eine intellektuelle Achterbahnfahrt!
Zunächst einmal, was genau verbirgt sich hinter diesem schillernden Begriff Geoengineering? Im Grunde geht es um großangelegte Eingriffe in die komplexen Systeme unseres Planeten – die Atmosphäre, die Ozeane, die Landflächen – mit dem Ziel, dem Klimawandel entgegenzuwirken. Man unterscheidet dabei grob zwei Hauptrichtungen, die unterschiedlicher kaum sein könnten in ihrer Herangehensweise und ihren potenziellen Konsequenzen. Da wären zum einen die Methoden zur Kohlendioxidentfernung (Carbon Dioxide Removal, CDR), die darauf abzielen, das Übel an der Wurzel zu packen und das überschüssige CO2 direkt wieder aus der Atmosphäre oder den Ozeanen herauszufiltern. Zum anderen gibt es das Management der Sonneneinstrahlung (Solar Radiation Management, SRM), oft auch als Albedo-Modifikation bezeichnet, das versucht, die Erderwärmung zu dämpfen, indem ein kleiner Teil des einfallenden Sonnenlichts reflektiert wird. Stellt euch vor, CDR sind die emsigen Aufräumer, die versuchen, die Party wieder in Ordnung zu bringen, nachdem zu viel Konfetti (CO2) verteilt wurde, während SRM eher wie ein riesiger Sonnenschirm wirkt, der die Hitze abhält, aber das Konfetti selbst unberührt lässt. Beide Ansätze haben ihre ganz eigenen Verlockungen und Tücken, wie die folgende Übersicht andeutet:
Hauptkategorie | Technologie-bezeichnung | Kurzbeschreibung des Prinzips | Hauptvorteile (potenziell) | Risiken (potenziell) |
CDR | Direkte CO2-Abscheidung aus der Luft (DAC) | Chemische/physikalische Extraktion von CO2 direkt aus der Umgebungsluft mit anschließender Speicherung. | Entfernt CO2 direkt; kann potenziell überall eingesetzt werden. | Hoher Energiebedarf; hohe Kosten; Skalierbarkeit; Speicherpermanenz und -sicherheit. |
Aufforstung/ Wiederaufforstung | Pflanzung von Bäumen zur CO2-Aufnahme durch Photosynthese und Speicherung in Biomasse und Böden. | Etablierte Methode; Co-Benefits für Biodiversität und Bodenschutz (bei richtiger Umsetzung). | Landnutzungskonkurrenz; Zeit bis zur vollen Wirksamkeit; Anfälligkeit für Brände/Krankheiten; Permanenz der Speicherung. | |
Bioenergie mit CO2-Abscheidung und -Speicherung (BECCS) | Verbrennung/Vergärung von Biomasse zur Energiegewinnung, wobei das entstehende CO2 abgeschieden und gespeichert wird. | Negativemissionen möglich (nachhaltige Biomasse); Energieerzeugung. | Immenser Land- und Wasserbedarf; Auswirkungen auf Ernährungssicherheit/Biodiversität; Kosten/Effizienz von CCS. | |
Beschleunigte Verwitterung (Enhanced Weathering, EW) | Ausbringung von fein gemahlenem Silikatgestein zur Beschleunigung der chemischen Bindung von CO2. | Potenziell große Kapazität; Co-Benefits Bodenfruchtbarkeit; Reduktion Ozeanversauerung. | Logistik Gesteinsabbau/-transport; ökologische Auswirkungen (Staub, Schwermetalle); langsame Reaktionsraten; MRV-Herausforderungen. | |
SRM | Stratosphärische Aerosolinjektion (SAI) | Einbringung reflektierender Aerosolpartikel in die Stratosphäre, um Sonnenlicht zurückzustreuen. | Schnelle globale Abkühlung möglich; potenziell kostengünstig. | Termination Shock; regionale Klimaänderungen; Ozonschädigung; keine Adressierung der Ozeanversauerung; Governance-Albtraum. |
Aufhellung mariner Wolken (MCB) | Versprühen von Meersalzpartikeln in niedrige Meereswolken, um deren Reflektivität zu erhöhen. | Potenzial zur regionalen Abkühlung, z.B. über Korallenriffen. | Unsichere Wirksamkeit; potenzielle regionale Wetteränderungen; Auswirkungen auf Küstenökosysteme; Logistik. |
Bleiben wir mal bei den CDR-Technologien, den "Staubsaugern" für atmosphärisches CO2. Hier tut sich gerade unglaublich viel! Besonders im Fokus steht die direkte Abscheidung aus der Luft, kurz DAC. Unternehmen wie Climeworks haben in Island bereits Pionierarbeit geleistet: Ihre "Orca"-Anlage, die seit 2021 läuft, und die noch viel größere "Mammoth"-Anlage, die im Mai 2024 den Betrieb aufnahm, sind faszinierende Beispiele dafür, wie CO2 direkt aus der Luft gefiltert und anschließend im Basaltgestein mineralisiert, also quasi versteinert, werden kann. Stellt euch diese riesigen Kollektoren vor, die wie gigantische Lungenflügel die Luft einsaugen und das CO2 binden! Und das ist erst der Anfang. In Texas entsteht mit dem Projekt STRATOS von Occidental und 1PointFive eine DAC-Anlage, die ab Mitte 2025 jährlich bis zu 500.000 Tonnen CO2 abscheiden soll – eine schier unglaubliche Menge. Auch Firmen wie Heirloom Carbon Technologies gehen spannende Wege, indem sie natürliche Mineralisierungsprozesse mit Kalkstein beschleunigen und bereits erste kommerzielle Anlagen in Kalifornien und bald auch in Louisiana betreiben. Man spürt förmlich die Aufbruchsstimmung und den Innovationsgeist in diesem Sektor, auch wenn die Herausforderungen wie der hohe Energiebedarf und die Kosten noch gewaltig sind.

Aber DAC ist nicht der einzige spannende CDR-Pfad. Habt ihr schon einmal von "Enhanced Weathering" gehört? Die Idee ist im Grunde, den natürlichen Verwitterungsprozess von Gesteinen, bei dem CO2 gebunden wird, künstlich zu beschleunigen. Man bringt fein gemahlenes Silikatgestein, oft Basalt, auf Ackerflächen aus. Das kann nicht nur CO2 binden, sondern, wie eine vielbeachtete Studie im US Corn Belt zeigte, sogar die Bodenfruchtbarkeit verbessern und Ernteerträge steigern! Forscher am Leverhulme Centre for Climate Change Mitigation in Sheffield untersuchen das an vielen Standorten weltweit, von Malaysia bis Illinois. Und dann gibt es da noch die Ozeane, unsere größten Kohlenstoffsenken. Hier wird an verschiedenen Fronten geforscht:
Erhöhung der Ozeanalkalinität (OAE): Hier versucht man, durch Zugabe basischer Mineralien die CO2-Aufnahmekapazität des Meerwassers zu steigern und gleichzeitig der Ozeanversauerung entgegenzuwirken. Initiativen wie die "Carbon to Sea Initiative" oder Unternehmen wie Ebb Carbon treiben hier die Forschung und Entwicklung voran.
Ozeandüngung (OF): Die Idee, durch gezielte Eisendüngung das Phytoplanktonwachstum anzukurbeln, um mehr CO2 zu binden, ist schon älter, aber sehr umstritten wegen der ökologischen Risiken wie schädliche Algenblüten. Die Forschung hierzu ist stark reguliert.
Algenanbau und Biomasseversenkung: Makroalgen wie Kelp wachsen schnell und nehmen dabei CO2 auf. Die geernteten Algen könnten dann in die Tiefsee versenkt werden, um den Kohlenstoff langfristig zu speichern. Auch hier gibt es spannende Projekte, aber auch Fragen zur Skalierbarkeit und zu ökologischen Auswirkungen.Der Ozean birgt also ein riesiges Potenzial, aber auch immense Herausforderungen und Verantwortlichkeiten.
Kommen wir nun zur anderen Seite der Medaille, dem Solar Radiation Management (SRM). Hier geht es nicht darum, das CO2 zu entfernen, sondern darum, die einfallende Sonnenstrahlung leicht zu reduzieren, um die globale Erwärmung direkt zu dämpfen. Die am intensivsten diskutierte Methode ist die Stratosphärische Aerosolinjektion (SAI). Die Idee ist, winzige reflektierende Partikel, ähnlich wie bei großen Vulkanausbrüchen, in die Stratosphäre einzubringen, um einen Teil des Sonnenlichts zurück ins All zu streuen. Das klingt erst einmal nach einer schnellen Lösung, birgt aber gewaltige Risiken: Was passiert, wenn man damit aufhört (der berüchtigte "Termination Shock")? Wie verändern sich regionale Wettermuster? Was ist mit der Ozonschicht? Und wer entscheidet über solch einen globalen Eingriff? Diese Fragen machen SAI zu einem der kontroversesten Themen überhaupt. Wenn ihr tiefer in die Welt der CDR-Projekte eintauchen oder immer die neuesten Erkenntnisse aus der Geoengineering-Forschung erhalten wollt, dann meldet euch doch für unseren monatlichen Newsletter an – das Formular findet ihr ganz oben auf dieser Seite! Es gibt so viel Spannendes zu entdecken.
Die Forschung zu SAI ist, verständlicherweise, von äußerster Vorsicht geprägt. Ein bekanntes Beispiel ist das SCoPEx-Projekt der Harvard University, das kleine Experimente in der Stratosphäre durchführen wollte, aber nach erheblichem Widerstand und ethischen Debatten im März 2024 eingestellt wurde, bevor jemals Partikel freigesetzt wurden. Dieser Fall zeigt eindrücklich, wie sensibel die Gesellschaft auf solche Pläne reagiert. Andere Programme wie das STAR-Programm von SilverLining oder die UKRI SRM Modelling Projekte setzen stark auf Modellierungen und die Analyse natürlicher Analoga wie Vulkanausbrüche, um die Risiken besser zu verstehen, ohne direkte Freisetzungsexperimente durchzuführen. Eine weitere SRM-Methode, die vor allem regional für Aufsehen sorgt, ist die Aufhellung mariner Wolken (Marine Cloud Brightening, MCB). In Australien laufen beispielsweise intensive Forschungs- und Entwicklungsarbeiten, um mit dieser Technik das Great Barrier Reef vor der Korallenbleiche zu schützen, indem man feine Meersalzpartikel versprüht, um die Wolken heller und reflektierender zu machen. Die folgende Tabelle gibt einen kleinen Einblick in ausgewählte SRM-Forschungsprogramme:
Projekt/Programm Name | Hauptakteure / Institutionen | Technologie | Hauptziele |
Harvard SCoPEx (abgeschlossen) | Harvard University | SAI (urspr. Kalziumkarbonat) | Verbesserung des Verständnisses der Stratosphärenchemie/-physik |
SilverLining STAR-Programm | SilverLining, NCAR, diverse Universitäten | SAI (Modellierung, Beobachtung, Aerosoltechnologie) | Verbesserung des Verständnisses von SAI-Auswirkungen, Risikobewertung, offene Daten |
UKRI SRM Modelling Initiative (allg.) | NERC, diverse UK Universitäten | SAI, MCB (Modellierung) | Risikobewertung, Schließung von Evidenzlücken, keine Freilandexperimente |
Great Barrier Reef Foundation RRAP - Cooling & Shading | Southern Cross Univ., AIMS, CSIRO u.a. | MCB, Fogging (experimentell und Modellierung) | Schutz des Riffs vor Korallenbleiche durch regionale Kühlung/Beschattung |
UKRI MACLOUD Projekt | Univ. Exeter, Leeds, Reading, Manchester, Oxford | MCB (Modellierung) | Potenzial von MCB zur Klimabekämpfung, Untersuchung von Wirksamkeit und Auswirkungen auf Erdsysteme |
Angesichts dieser gewaltigen Pläne und potenziellen Auswirkungen ist es natürlich entscheidend, was die großen internationalen Organisationen dazu sagen. Der Weltklimarat (IPCC) beispielsweise sieht CDR-Methoden zunehmend als notwendigen Bestandteil, um die Pariser Klimaziele zu erreichen und Restemissionen auszugleichen. Gleichzeitig warnt er aber vor den Risiken bei großflächiger Anwendung, etwa Landnutzungskonflikten bei Aufforstung oder BECCS. SRM-Technologien hingegen werden vom IPCC deutlich kritischer gesehen, vor allem wegen der unkalkulierbaren Risiken, des Termination Shocks und der Tatsache, dass sie die Ursache des Problems – die CO2-Konzentration – nicht angehen. Ähnlich äußern sich auch die Nationalen Akademien der USA (NASEM), die zwar ein vorsichtiges, streng reguliertes Forschungsprogramm zu SRM empfehlen, um Wissenslücken zu schließen, aber gleichzeitig betonen, dass dies nicht den Weg für eine Anwendung ebnen dürfe. Die Royal Society im Vereinigten Königreich betont seit langem, dass Emissionsreduktionen absolute Priorität haben müssen und Geoengineering keine Alternative darstellt, sieht aber Forschungsbedarf, um Optionen und Risiken besser zu verstehen.

Und damit sind wir bei einem ganz entscheidenden Punkt: den Risiken und Nebenwirkungen. Jede Geoengineering-Technologie hat ihr eigenes Risikoprofil, das wir uns genauer ansehen müssen. Bei SRM-Methoden wie SAI sind das neben dem bereits erwähnten Termination Shock vor allem unvorhersehbare regionale Klimaänderungen – manche Regionen könnten von Dürren heimgesucht werden, andere von Überschwemmungen. Hinzu kommen mögliche Schäden an der Ozonschicht oder veränderte Lichtverhältnisse, die das Pflanzenwachstum beeinflussen. Und ganz wichtig: SRM bekämpft nicht die Ozeanversauerung! Bei den CDR-Methoden stehen andere Risiken im Vordergrund. Großflächige Aufforstung oder der Anbau von Biomasse für BECCS konkurrieren mit der Nahrungsmittelproduktion um wertvolles Land und Wasser. DAC-Anlagen benötigen sehr viel Energie – stammt diese nicht aus erneuerbaren Quellen, ist der Klimaeffekt fragwürdig. Bei der beschleunigten Verwitterung könnten Schwermetalle in Böden gelangen, und bei der Speicherung von CO2 im Untergrund (CCS) muss die Langzeitsicherheit gewährleistet sein.
Geoengineering-Kategorie | Hauptrisiken (ökologisch, technisch, sozioökonomisch) | Ethische Hauptbedenken |
Stratosphärische Aerosolinjektion (SAI) | Termination Shock; regionale Klimaänderungen; Ozonschädigung; Auswirkungen auf Ökosysteme, Landwirtschaft, Gesundheit; Unumkehrbarkeit einiger Effekte. | Moral Hazard; Gerechtigkeit (ungleiche Risikoverteilung); Generationengerechtigkeit; Kontrollillusion; Missbrauchspotenzial. |
Aufhellung mariner Wolken (MCB) | Regionale Wetteränderungen; Auswirkungen auf marine und Küstenökosysteme; Unsicherheiten bzgl. Wirksamkeit und Skalierbarkeit. | Ähnlich wie SAI, aber potenziell regional begrenzter; Auswirkungen auf lokale Gemeinschaften. |
Direkte CO2-Abscheidung (DAC) | Hoher Energiebedarf; Kosten; Wasserbedarf; Landnutzung für Anlagen/Energie; CO2-Speichersicherheit und -permanenz. | Gerechter Zugang zu Technologie/Nutzen; Verteilung von Kosten/Lasten; "Lock-in" in fossile Infrastruktur bei EOR. |
Beschleunigte Verwitterung (EW) | Ökologische Auswirkungen durch Gesteinsabbau/-transport/-ausbringung; Freisetzung von Spurenmetallen; Veränderung Boden-/Wasserchemie. | Landnutzungsrechte; Auswirkungen auf lokale Ökosysteme/Gesundheit; Gerechtigkeit bei Ressourcennutzung. |
Erhöhung der Ozeanalkalinität (OAE) | Veränderung Meereschemie; Ausfällung von Mineralien; Auswirkungen auf marine Organismen/Nahrungsnetze; Logistik/Kosten Materialausbringung. | Auswirkungen auf marine Ökosysteme/Fischerei; Gerechtigkeit bei Nutzung mariner Ressourcen. |
Diese Risiken führen uns direkt zu den tiefgreifenden ethischen Fragen. Da ist zum einen der "Moral Hazard": Könnte die bloße Existenz von Geoengineering-Optionen uns davon abhalten, unsere Emissionen drastisch genug zu senken? Wer entscheidet über den Einsatz solcher global wirksamen Technologien, und wer trägt die Konsequenzen, wenn etwas schiefgeht? Hier geht es um globale Gerechtigkeit, denn oft sind es die Länder und Gemeinschaften, die am wenigsten zum Klimawandel beigetragen haben, die am verwundbarsten für dessen Folgen und auch für die Risiken von Geoengineering wären. Und welche Verantwortung tragen wir gegenüber zukünftigen Generationen, denen wir möglicherweise eine Welt hinterlassen, die auf Dauer künstlich im Gleichgewicht gehalten werden muss? Das sind keine leichten Fragen, und sie erfordern eine breite gesellschaftliche Debatte.
Eng damit verknüpft ist die Frage der Governance. Wer setzt die Spielregeln für Forschung und einen potenziellen Einsatz fest? Aktuell ist die internationale Governance-Landschaft für Geoengineering eher ein Flickenteppich. Es gibt zwar Abkommen wie das Übereinkommen über die biologische Vielfalt (CBD), das ein De-facto-Moratorium für Biodiversität-schädigende Geoengineering-Aktivitäten vorsieht, oder das Londoner Protokoll, das die Ozeandüngung reguliert, aber ein umfassendes, spezifisches Regelwerk fehlt. Das ist besonders heikel, weil einige Technologien potenziell von einzelnen Staaten oder Akteuren unilateral eingesetzt werden könnten, mit globalen Folgen. Die Rufe nach einem robusten, transparenten und international abgestimmten Governance-Rahmen, der auf dem Vorsorgeprinzip beruht, werden daher immer lauter.

Trotz aller Risiken und Debatten, oder vielleicht gerade deswegen, ist der Markt für CO2-Entfernung (CDR) bereits in Bewegung. Unternehmen setzen sich Netto-Null-Ziele und fragen vermehrt nach Möglichkeiten, unvermeidbare Emissionen auszugleichen. Der Markt für CDR-Gutschriften wächst rasant, mit Prognosen, die in die Milliarden gehen. Führende Technologien sind hier DAC, BECCS und Enhanced Weathering. Aber auch hier gilt: Die tatsächliche, verifizierte Entfernung von CO2 hinkt den Verkaufszahlen noch hinterher. Es ist ein junger Markt voller Chancen, aber auch voller Herausforderungen, was die Glaubwürdigkeit und die tatsächliche Klimawirkung angeht.
Was bringt also die Zukunft? Geoengineering ist ein Feld, das sich unglaublich schnell entwickelt. Die Forschung geht weiter, neue Konzepte entstehen, und die Debatte über Chancen und Risiken wird uns sicher noch lange begleiten. Es ist eine Reise ins Unbekannte, bei der jeder Schritt wohlüberlegt sein muss. Ist Geoengineering ein verzweifelter Notnagel, wenn alle anderen Stricke reißen, oder kann es ein verantwortungsvoll eingesetzter Baustein in einer umfassenden Klimastrategie sein, die an erster Stelle immer drastische Emissionsreduktionen und Anpassungsmaßnahmen setzen muss? Die Antwort darauf ist noch nicht geschrieben und hängt von uns allen ab – von der Wissenschaft, der Politik, der Wirtschaft und von jeder und jedem Einzelnen von uns in der Gesellschaft.
Diese Entdeckungsreise durch die Welt des Geoengineerings ist wirklich atemberaubend und wirft so viele Fragen auf. Ich hoffe, dieser kleine Einblick hat eure Neugier geweckt und euch vielleicht auch ein wenig ins Grübeln gebracht. Was sind eure Gedanken dazu? Seht ihr darin eine Chance, eine Gefahr oder beides? Lasst es uns in den Kommentaren wissen – ich bin unglaublich gespannt auf eure Meinungen und eine lebhafte Diskussion! Und wenn euch dieser Beitrag gefallen hat, dann zeigt es uns doch mit einem Like und teilt ihn mit Menschen, die sich ebenfalls für die großen Zukunftsfragen unseres Planeten interessieren. Für noch mehr spannende Einblicke und hintergründige Analysen aus der Welt der Wissenschaft könnt ihr uns natürlich auch auf unseren Social-Media-Kanälen folgen:
Bleibt neugierig!
#Geoengineering #Klimawandel #CDR #SRM #Klimaforschung #Nachhaltigkeit #Technologie #Ethik #Zukunft #Innovation
Verwendete Quellen:
Definition und Klassifizierung von Geoengineering-Ansätzen - IPCC www.ipcc.ch
Geoengineering - Center for International Environmental Law | CIEL www.ciel.org
Governing the Atmosphere: Towards a Legal Regime for Geoengineering - Columbia Black Pre-Law Society blackprelaw.studentgroups.columbia.edu
An Introduction to Geoengineering - Verisk core.verisk.com
The Harvard Solar Geoengineering Research Program - The Salata Institute salatainstitute.harvard.edu
Geoengineering-Governance - Umweltbundesamt www.umweltbundesamt.de
Academies Panel Proposes Cautious Geoengineering Research Initiative - AIP.ORG ww2.aip.org
Global Carbon Dioxide Removal (CDR) Market Report 2025-2045 - Business Wire www.businesswire.com
Orca Pioneers Large-Scale Carbon Capture to Combat Climate Change - Winssolutions www.winssolutions.org
Enhanced weathering in the US Corn Belt delivers carbon removal with agronomic benefits | PNAS www.pnas.org
Carbon Dioxide Removal - NOAA Ocean Acidification Program oceanacidification.noaa.gov
What is marine cloud brightening? - Great Barrier Reef Foundation www.barrierreef.org
Geoengineering the climate: an overview and update | Philosophical Transactions of the Royal Society A royalsocietypublishing.org
Project: Orca - Klimate.co www.klimate.co
Mammoth: our newest direct air capture and storage facility - Climeworks climeworks.com
Occidental and 1PointFive Secure Class VI Permits for STRATOS... - Occidental www.oxy.com
Heirloom Carbon Technologies Announces $475 Million Investment... - Opportunity Louisiana www.opportunitylouisiana.gov
Leverhulme Centre for Climate Change Mitigation - University of Sheffield www.sheffield.ac.uk
A New OAE Model Intercomparison Project Has Launched - Carbon to Sea Initiative carbontosea.org
Ebb Carbon Raises $20 million Series A... - Business Wire www.businesswire.com
Controversial Harvard Geoengineering Project Abandoned... - The Harvard Crimson www.thecrimson.com
STratospheric Aerosol Research Program - Silverlining.ngo www.silverlining.ngo
Modelling the impact of solar radiation modification - UKRI www.ukri.org
IPCC, geoengineering and pathways out of climate chaos - Geoengineering Monitor www.geoengineeringmonitor.org
Reflecting Sunlight: Recommendations for Solar Geoengineering Research and Research Governance - National Academies www.nationalacademies.org




























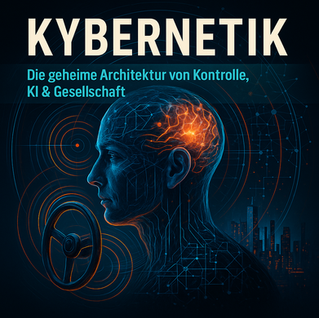

















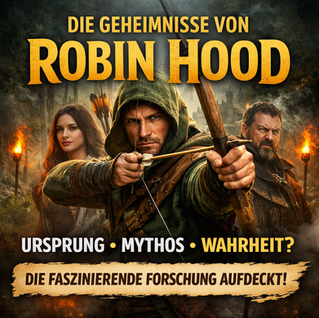





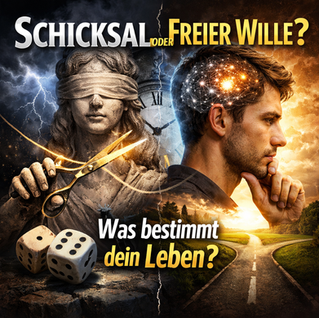









































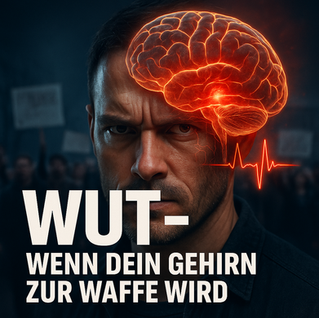












Kommentare