Cholesterin senken: Warum Eier nicht der Feind sind und was dein Herz wirklich schützt
- Benjamin Metzig
- 28. Juli 2025
- 11 Min. Lesezeit
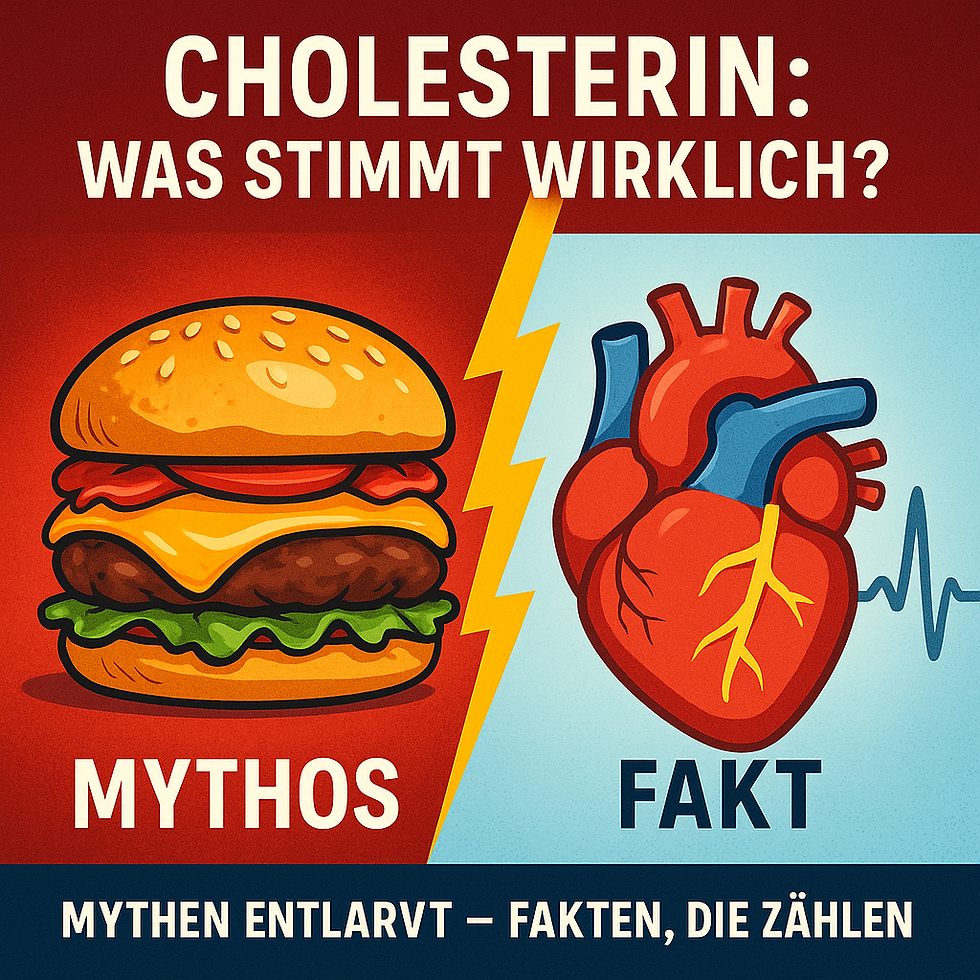
Hallo Wissens-Junkies und willkommen zu einer neuen Entdeckungsreise! Heute packen wir ein Thema an, das in fast jeder Familienfeier, in jeder Gesundheitszeitschrift und in unzähligen Online-Foren für hitzige Debatten sorgt: Cholesterin. Ein Wort, das fast schon bedrohlich klingt. Wir assoziieren es mit fettigem Essen, verstopften Arterien, Herzinfarkt und dem mahnenden Zeigefinger unseres Arztes. Cholesterin – der öffentliche Feind Nummer eins für unsere Herzgesundheit.
Aber was, wenn ich euch sage, dass diese Geschichte, so wie wir sie oft hören, voller Missverständnisse, veralteter Mythen und gefährlicher Halbwahrheiten steckt? Was, wenn ich euch erzähle, dass Cholesterin an sich nicht böse ist, sondern ein überlebenswichtiger Superheld in unserem Körper? Und dass das eigentliche Drama nicht im Molekül selbst liegt, sondern in einer komplexen Geschichte über Transport, Genetik und Entzündung?
Schnallt euch an, denn wir werden heute gemeinsam den Staub von alten Dogmen pusten und einen glasklaren Blick auf die faszinierende Wissenschaft hinter dem Cholesterin werfen. Wir klären, warum das Frühstücksei zu Unrecht am Pranger stand, welche Faktoren wirklich unsere Arterien gefährden und wie eine moderne, personalisierte Medizin heute aussieht. Diese Reise wird eure Sichtweise auf Ernährung, Risiko und Gesundheit für immer verändern.
Klingt spannend? Wenn ihr keine unserer tiefgehenden Analysen mehr verpassen wollt, dann meldet euch doch direkt für unseren monatlichen Newsletter an! Dort bekommt ihr die besten Wissenschafts-Storys direkt in euer Postfach.
Das missverstandene Molekül – Warum wir ohne Cholesterin nicht leben könnten
Stellt euch vor, Cholesterin wäre eine Person. In der öffentlichen Wahrnehmung ist sie ein Schurke, ein hinterhältiger Saboteur, der unsere Gefäße von innen zerstört. Doch in der Welt der Biochemie ist Cholesterin eher ein unbesungener Held, ein unverzichtbarer Alleskönner, der an fast allen wichtigen Bauprojekten unseres Körpers beteiligt ist.
Chemisch gesehen ist Cholesterin eine fettähnliche, wachsartige Substanz. Und hier liegt schon der erste entscheidende Punkt: Es ist fettähnlich, also nicht wasserlöslich. Das ist wie Öl in Wasser – es löst sich nicht auf. Unser Blut ist aber eine wässrige Lösung. Wie also kommt dieses lebenswichtige, aber "wasserscheue" Molekül von A nach B? Es braucht spezielle Transport-Taxis: die sogenannten Lipoproteine. Merkt euch das gut, denn diese Taxis sind die eigentlichen Hauptdarsteller in unserem Drama.
Doch wofür brauchen wir diesen Aufwand überhaupt? Die Aufgaben von Cholesterin sind absolut fundamental:
Zell-Architekt: Jede einzelne Zelle in unserem Körper ist von einer Membran umgeben. Cholesterin ist ein zentraler Baustein dieser Membranen und sorgt für die nötige Stabilität und Flexibilität. Ohne Cholesterin würden unsere Zellen einfach zerfließen.
Hormon-Fabrik: Es ist die Vorläufersubstanz für eine ganze Armada an wichtigen Steroidhormonen. Dazu gehören die Sexualhormone Testosteron und Östrogen, aber auch Stresshormone wie Cortisol, das unseren Stoffwechsel steuert.
Vitamin-D-Produzent: Die Synthese des "Sonnenvitamins" D in unserer Haut, das für gesunde Knochen unerlässlich ist, startet mit einem Cholesterin-Derivat.
Verdauungshelfer: In der Leber wird Cholesterin zu Gallensäuren umgewandelt. Diese sind quasi das Spülmittel für unsere Fettverdauung im Darm. Ohne sie könnten wir Fette aus der Nahrung kaum aufnehmen.
Seht ihr? Unser Körper ist auf Cholesterin angewiesen. Und weil es so wichtig ist, überlässt er nichts dem Zufall. Er stellt den Löwenanteil von etwa 80 % einfach selbst her, hauptsächlich in der Leber. Nur die restlichen 20 % nehmen wir über tierische Nahrung auf. Der Körper hat sogar einen cleveren Regelkreis: Essen wir mehr Cholesterin, drosselt die Leber die Eigenproduktion. Essen wir weniger, kurbelt sie sie an.
Das eigentliche Problem ist also selten die Zufuhr von außen, sondern eine Störung in diesem internen Regelkreis. Und hier kommt die Genetik ins Spiel. Die entscheidenden Türsteher in diesem System sind die LDL-Rezeptoren auf unseren Leberzellen. Ihre Aufgabe ist es, die Cholesterin-Taxis namens LDL aus dem Blut zu fischen und sie aus dem Verkehr zu ziehen. Wie ein "Experiment der Natur" beweist, ist ihre Funktion entscheidend: Menschen mit der Erbkrankheit "familiäre Hypercholesterinämie" (FH) haben von Geburt an zu wenige oder defekte LDL-Rezeptoren. Ihr LDL-Cholesterin staut sich massiv im Blut an, und sie erleiden oft schon mit 30 oder 40 Jahren Herzinfarkte. Das beweist zweifelsfrei: Ein lebenslang hoher LDL-Spiegel ist nicht nur ein "Risikofaktor", er ist eine direkte Ursache für Gefäßerkrankungen.
Die "guten" und "bösen" Transport-Taxis: HDL und LDL
Um die Cholesterin-Debatte zu verstehen, müssen wir uns die zwei wichtigsten Transport-Taxis genauer ansehen:
LDL (Low-Density-Lipoprotein): Das ist der "Lieferdienst". LDL-Partikel transportieren Cholesterin von der Leber zu den Zellen im ganzen Körper. Wenn aber zu viele dieser Lieferwagen unterwegs sind und die Zellen keine Fracht mehr annehmen (z.B. weil die Rezeptor-Türen klemmen), irren sie im Blut umher. Sie neigen dazu, in den Arterienwänden "hängen zu bleiben" und dort Schaden anzurichten. Deshalb nennt man LDL-Cholesterin das "böse" Cholesterin.
HDL (High-Density-Lipoprotein): Das ist die "Müllabfuhr". HDL-Partikel sammeln überschüssiges Cholesterin aus den Zellen und sogar aus den Gefäßwänden wieder ein und bringen es zurück zur Leber, wo es recycelt oder entsorgt wird. Wegen dieser Aufräumfunktion gilt HDL-Cholesterin als das "gute" Cholesterin.
Lange dachte man, die Lösung sei einfach: LDL runter, HDL rauf. Doch die Wissenschaft ist weiter. Während die Schädlichkeit eines hohen LDL-Spiegels unumstößlich bewiesen ist, ist die Rolle von HDL komplizierter. Studien mit Medikamenten, die das HDL künstlich erhöhten, konnten das Herzinfarktrisiko nicht senken. Es scheint, als sei ein hoher HDL-Wert eher ein Marker für einen gesunden Stoffwechsel, aber nicht das eigentliche Ziel der Therapie. Manche Studien deuten sogar darauf hin, dass extrem hohe HDL-Werte schädlich sein könnten.
Die klare wissenschaftliche Botschaft heute lautet: Der Fokus der Prävention und Therapie liegt eindeutig auf dem LDL-Cholesterin. Den LDL Cholesterin senken ist die nachweislich wirksamste Strategie, um unsere Gefäße zu schützen.
Der schleichende Prozess – Wie aus Leben Not wird
Wie genau verwandelt sich unser lebenswichtiger Baustoff in einen Krankmacher? Die Antwort hat einen Namen: Atherosklerose. Und vergesst bitte sofort das Bild eines alten, verkalkten Wasserrohrs! Atherosklerose ist kein mechanisches Verstopfen, sondern ein hochkomplexer, chronischer Entzündungsprozess in der Wand unserer Arterien. Es ist wie eine Wunde, die unter der Oberfläche über Jahrzehnte schwelt und heilt und wieder aufbricht. Und das LDL-Partikel ist der Brandbeschleuniger.
Stellt euch den Prozess in vier Akten vor:
Das Leck in der Mauer: Alles beginnt mit einer winzigen Verletzung der innersten Schicht unserer Arterien, dem Endothel. Diese hauchdünne Tapete kann durch Risikofaktoren wie Bluthochdruck, Rauchen oder Diabetes undicht werden. Durch diese Lücken dringen nun LDL-Partikel aus dem Blut in die Gefäßwand ein und bleiben dort stecken.
Der falsche Alarm: In der Gefäßwand werden die LDL-Partikel chemisch verändert (oxidiert). Dieses "oxidierte LDL" wirkt auf unser Immunsystem wie ein gefährlicher Eindringling. Das Immunsystem schlägt Alarm und schickt seine Bodentruppen, die Makrophagen ("Fresszellen"), an den Ort des Geschehens.
Die Fressorgie mit Folgen: Die Makrophagen stürzen sich auf das oxidierte LDL und fressen es hemmungslos auf. Sie saugen sich so voll mit Fett, dass sie sich in sogenannte Schaumzellen verwandeln. Eine Ansammlung dieser Schaumzellen ist die erste sichtbare Stufe der Atherosklerose, ein sogenannter "Fettstreifen".
Die Bildung der Plaque und die tickende Zeitbombe: Die Entzündung kocht weiter. Immer mehr Immunzellen strömen herbei, Schaumzellen platzen und setzen ihren fettigen Inhalt frei. Es entsteht ein lipidreicher Kern. Gleichzeitig versucht der Körper, den Schaden zu begrenzen, indem er eine Art Deckel aus Bindegewebe über diesen Kern baut – die fibröse Kappe. Diese gesamte Struktur nennen wir eine atherosklerotische Plaque. Solange die Kappe dick und stabil ist, verengt die Plaque zwar das Gefäß, ist aber relativ harmlos. Das Problem: Die chronische Entzündung in der Plaque produziert Enzyme, die diese Schutzkappe von innen zersetzen und dünn und brüchig machen. Wenn diese instabile Kappe aufreißt, kommt der hochgradig gerinnungsfördernde Inhalt mit dem Blut in Kontakt. Sofort bildet sich ein Blutgerinnsel (Thrombus). Verschließt dieses Gerinnsel das Gefäß schlagartig, kommt es zur Katastrophe: im Herzen zum Herzinfarkt, im Gehirn zum Schlaganfall.
Diese Erkenntnis ist revolutionär: Nicht unbedingt die Größe der Plaque ist entscheidend, sondern ihre Stabilität. Eine kleine, aber hochentzündliche, "heiße" Plaque ist viel gefährlicher als eine große, stabile, "kalte" Plaque. Das erklärt auch, warum Medikamente wie Statine so gut wirken: Sie senken nicht nur das LDL, sie wirken auch antientzündlich und stabilisieren die Plaques.
Die Komplizen: Triglyceride und der stille Killer Lipoprotein(a)
Es wäre zu einfach, nur dem LDL die Schuld zu geben. Es gibt noch zwei weitere wichtige Akteure im Lipid-Drama:
Triglyceride: Das sind unsere Haupt-Energiespeicherfette. Lange unterschätzt, wissen wir heute: Erhöhte Triglyzeridwerte (über 150 mg/dl) sind ein unabhängiger Risikofaktor für Herzerkrankungen. Sie sind oft Teil eines ungesunden Gesamtpakets, das man "metabolisches Syndrom" nennt: Übergewicht, niedrige HDL-Werte und besonders kleine, dichte und aggressive LDL-Partikel. Anders als Cholesterin reagieren Triglyzeride sehr stark auf unseren Lebensstil, vor allem auf Zucker, Alkohol und Übergewicht.
Lipoprotein(a) oder Lp(a): Das ist der heimtückischste Risikofaktor von allen. Stellt euch ein LDL-Partikel vor, an das ein zusätzliches, klebriges Protein (Apo(a)) angeheftet ist. Dieses Lp(a) hat eine unheilvolle Doppelfunktion: Es ist wie LDL plaque-fördernd (atherogen) und es stört die körpereigene Auflösung von Blutgerinnseln, fördert also Thrombosen (prothrombotisch). Das Schlimmste daran: Der Lp(a)-Spiegel ist zu über 90 % genetisch festgelegt. Man kann ihn weder durch Diät noch durch Sport oder die gängigen Statine beeinflussen. Viele Menschen haben einen optimal eingestellten LDL-Wert, erleiden aber trotzdem einen Herzinfarkt – oft ist ein unerkannter, hoher Lp(a)-Wert die Ursache. Deshalb empfehlen führende Fachgesellschaften heute, dass jeder Erwachsene mindestens einmal im Leben seinen Lp(a)-Wert bestimmen lassen sollte, um dieses verborgene Risiko aufzudecken.
Der Ernährungs-Kompass – Mit diesen Lebensmitteln das Cholesterin senken
Willkommen im größten Minenfeld der Gesundheitsdebatte: der Ernährung. Kaum ein Thema ist so verseucht von Mythen und veralteten Ratschlägen. Zeit, aufzuräumen!
Das böse Frühstücksei
Jahrzehntelang war das Ei der Buhmann. Ein einziges Ei enthält eine beachtliche Menge Cholesterin, also schien die Rechnung einfach: Eier essen = hoher Cholesterinspiegel. Falsch! Wie wir gelernt haben, stellt unser Körper den Großteil des Cholesterins selbst her und reguliert die Produktion je nach Zufuhr von außen. Zahlreiche große Studien haben gezeigt: Für die meisten gesunden Menschen hat die Cholesterinaufnahme aus der Nahrung kaum einen Einfluss auf den Blutcholesterinspiegel. Der Konsum von bis zu einem Ei pro Tag gilt heute als völlig unbedenklich.
Das Problem bei vielen alten Studien war der Kontext: In den USA isst man Eier oft mit Speck, Wurst und Weißbrot-Toast – also einer Ladung gesättigter Fette und raffinierter Kohlenhydrate. Das ist das Problem, nicht das Ei. Ein Ei mit Avocado und Vollkornbrot ist eine völlig andere Geschichte.
Die wahren Bösewichte auf dem Teller
Wenn es nicht das Nahrungscholesterin ist, was treibt dann unser LDL in die Höhe? Die Wissenschaft kennt die wahren Schuldigen:
Gesättigte Fettsäuren: Sie sind der stärkste diätetische Faktor, der die Leber anregt, mehr LDL-Cholesterin zu produzieren. Hauptquellen: fettes Fleisch, Wurst, Butter, Sahne, vollfetter Käse und tropische Fette wie Kokos- und Palmfett.
Transfette: Der absolute Super-Schurke. Sie entstehen bei der industriellen Härtung von Fetten und stecken in Fertigprodukten, Backwaren, Frittiertem und Fast Food. Sie sind doppelt schlecht: Sie erhöhen das "böse" LDL und senken gleichzeitig das "gute" HDL. Unbedingt meiden!
Zucker und raffinierte Kohlenhydrate: Sie treiben zwar nicht direkt das LDL in die Höhe, aber sie sind der Haupttreiber für hohe Triglyzeridwerte. Die Leber wandelt überschüssigen Zucker direkt in Triglyzeride um.
Die herzgesunde Ernährung in der Praxis
Die wirksamste Ernährungsstrategie ist also keine streng cholesterinarme Diät, sondern eine fettmodifizierte und ballaststoffreiche Ernährung. Das heißt konkret:
Tausche Fette aus: Ersetze gesättigte Fette (Butter, fettes Fleisch) durch ungesättigte Fette. Das sind die guten Fette!
Einfach ungesättigte: Olivenöl, Rapsöl, Avocados.
Mehrfach ungesättigte: Omega-3-Fettsäuren aus fettem Seefisch (Lachs, Hering), Leinöl und Walnüssen.
Setze auf Pflanzenkraft: Die Basis sollten Gemüse, Obst, Hülsenfrüchte (Linsen, Bohnen) und Nüsse bilden.
Werde Ballaststoff-Champion: Mindestens 30 Gramm Ballaststoffe pro Tag! Besonders wirksam sind lösliche Ballaststoffe aus Haferflocken (Beta-Glucan), Gerste und Äpfeln. Sie binden im Darm Gallensäuren, die dann ausgeschieden werden. Die Leber muss neue Gallensäuren aus Cholesterin produzieren und holt sich dieses dafür aus dem Blut – ein genialer Trick, um das LDL Cholesterin senken zu können.
Vollkorn vor!: Wähle bei Brot, Nudeln und Reis immer die Vollkornvariante.
Eine Ernährungsumstellung allein kann den LDL-Spiegel um beachtliche 10-15 % senken. Für viele Menschen ist das ein riesiger Schritt. Aber man muss auch realistisch sein: Bei sehr hohem Risiko oder genetischer Veranlagung reicht das oft nicht aus, um die sicheren Zielwerte zu erreichen.
Was deine Zahlen wirklich bedeuten – Schluss mit dem Raten
Ein Lipid-Check beim Arzt misst typischerweise Gesamtcholesterin, LDL, HDL und Triglyzeride. Aber die entscheidende Frage ist nicht: "Ist mein Wert normal?". Die moderne Medizin fragt: "Welcher Wert ist für MICH persönlich sicher?"
Es gibt keinen universellen Normalwert. Ein LDL-Wert von 130 mg/dl kann für einen jungen, gesunden Nichtraucher völlig okay sein. Derselbe Wert ist für einen Diabetiker mit einem früheren Herzinfarkt eine tickende Zeitbombe.
Ärzte nutzen heute Risikorechner (z.B. den ESC-SCORE), die Alter, Geschlecht, Raucherstatus, Blutdruck und Cholesterinwerte einbeziehen, um das individuelle 10-Jahres-Risiko für einen Herzinfarkt oder Schlaganfall zu berechnen. Basierend auf diesem Risiko werden klare LDL-Zielwerte definiert. Das Prinzip ist einfach und logisch: Je höher dein Gesamtrisiko, desto niedriger muss dein LDL-Zielwert sein.
Sehr hohes Risiko: (z.B. nach Herzinfarkt/Schlaganfall, mit Diabetes und Organschäden): Ziel-LDL < 55 mg/dl.
Hohes Risiko: (z.B. stark erhöhte Einzelrisikofaktoren wie LDL > 190 mg/dl, familiäre Hypercholesterinämie): Ziel-LDL < 70 mg/dl.
Moderates Risiko: Ziel-LDL < 100 mg/dl.
Niedriges Risiko: Ziel-LDL < 116 mg/dl.
Diese strengen, wissenschaftlich fundierten Zielwerte zeigen, wie ernst die Medizin das Thema LDL Cholesterin senken nimmt. Es geht darum, ein Schutzniveau zu erreichen, das nachweislich Ereignisse verhindert.
Der Werkzeugkasten für dein Herz – Von Lebensstil bis Hightech-Medizin
Das Management hoher Cholesterinwerte ist ein Stufenplan, der immer auf demselben Fundament aufbaut:
Stufe 1: Der Lebensstil (Das Fundament)
Ernährungsumstellung, regelmäßige Bewegung (mindestens 150 Minuten pro Woche), Gewichtsmanagement und ein strikter Rauchstopp sind die absolute, nicht verhandelbare Basis jeder Therapie.
Stufe 2: Statine (Der Goldstandard)
Wenn der Lebensstil allein nicht ausreicht, um die individuellen Zielwerte zu erreichen – was bei hohem Risiko fast immer der Fall ist – kommen Medikamente ins Spiel. Die erste Wahl sind Statine. Sie blockieren ein Schlüsselenzym in der Leber und drosseln so die körpereigene Cholesterinproduktion. Daraufhin baut die Leber mehr LDL-Rezeptoren auf ihrer Oberfläche, um mehr LDL aus dem Blut zu fischen. Das Ergebnis: Das LDL-Cholesterin sinkt massiv, oft um 30-50 % oder mehr.
Die Wirksamkeit von Statinen ist durch Studien an Hunderttausenden Menschen über Jahrzehnte zweifelsfrei belegt. Sie retten Leben. Die in den Medien oft übertrieben dargestellten Nebenwirkungen (wie Muskelschmerzen) treten zwar auf, sind aber im Vergleich zum lebensrettenden Nutzen meist beherrschbar oder selten. Die Entscheidung für eine Statin-Therapie ist keine persönliche Niederlage, sondern bei hohem Risiko eine biologische und mathematische Notwendigkeit.
Stufe 3: Die modernen Helfer (Kombinationstherapie)
Wenn Statine allein nicht ausreichen oder nicht vertragen werden, gibt es weitere Optionen, die man kombiniert:
Ezetimib: Blockiert die Aufnahme von Cholesterin im Darm.
Bempedoinsäure: Ein neuerer Wirkstoff, der ebenfalls die Cholesterinproduktion hemmt.
PCSK9-Inhibitoren: Das ist die absolute Hightech-Artillerie. Diese Antikörper werden gespritzt und verhindern den Abbau von LDL-Rezeptoren. Das Ergebnis ist eine dramatische Erhöhung der Rezeptorzahl und eine massive Senkung des LDL-Spiegels um weitere 50-60 %.
Ausblick: Die nächste Revolution steht bevor
Die Forschung schläft nicht. Die nächste große Revolution zielt auf das bisher unbehandelbare Lipoprotein(a). Neue, auf Gentechnik basierende Medikamente (sogenannte Antisense-Oligonukleotide und siRNA-Therapien) sind in der finalen Testphase. Sie können die Produktion von Lp(a) in der Leber gezielt blockieren und den Spiegel um über 90 % senken. Ihre Zulassung wird eine der letzten großen Lücken in der Herz-Kreislauf-Prävention schließen.
Wir sind von einer pauschalen Verteufelung des Cholesterins zu einem unglaublich differenzierten, personalisierten und wirksamen Management gelangt. Die Mythen sind entlarvt, die Fakten liegen auf dem Tisch. Dieses Wissen gibt uns die Macht, unsere Gesundheit selbst in die Hand zu nehmen, die richtigen Fragen zu stellen und gemeinsam mit unseren Ärzten die besten Entscheidungen für ein langes und gesundes Leben zu treffen.
Was für eine Reise! Hat dieser tiefe Einblick eure Sicht auf Cholesterin verändert? Habt ihr euren Lp(a)-Wert schon mal messen lassen? Lasst uns in den Kommentaren diskutieren! Wenn euch der Beitrag gefallen hat, lasst ein Like da und teilt ihn mit allen, die immer noch Angst vor dem Frühstücksei haben!
Für noch mehr Wissenschaft, die im Alltag ankommt, folgt uns unbedingt auch auf unseren Social-Media-Kanälen. Werdet Teil unserer Community!
#Cholesterin #Herzgesundheit #Atherosklerose #LDL #Prävention #Ernährungsmythen #Wissenschaft #Medizin #Statine #LipoproteinA
Verwendete Quellen:
Was ist an Cholesterin gefährlich? - Deutsche Herzstiftung - https://herzstiftung.de/ihre-herzgesundheit/gesund-bleiben/cholesterin/was-ist-cholesterin
Was ist Cholesterin? Wichtige Infos zum Lipid - https://www.lipide.info/cholesterin-und-lipide/was-ist-cholesterin
Cholesterinwerte: Risiko für Folgeerkrankungen senken - Sanofi - https://www.sanofi.de/de/magazin/ihre-gesundheit/cholesterinwerte-risiko-fuer-folgeerkrankungen-senken
Cholesterin | Gesundheitsinformation.de - https://www.gesundheitsinformation.de/cholesterin.html
Schluss mit dem Ernährungsmythos: Ostereier sind gesund - Envivas Krankenversicherung - https://www.envivas.de/magazin/gesundheitswissen/ostereier-sind-gesund
Fette - gesättigte und ungesättigte - Transfettsäuren ... - gesundheit.gv - https://www.gesundheit.gv.at/leben/ernaehrung/info/fette.html
Was ist Cholesterin? Welchen Einfluss hat Cholesterin auf unsere Gefäßgesundheit und das Schlaganfall-Risiko? - https://www.schlaganfall-hilfe.de/fileadmin/files/SDSH/PDF/flyer_cholesterin_factsheet2023.pdf
Merkblatt Ernährung und erhöhter Cholesterinspiegel / November 2011 - https://www.sge-ssn.ch/media/merkblatt_ernaehrung_und_erhoehter_cholesterinspiegel_2011.pdf
LDL-Cholesterin: Risikofaktor für Gefäße | Apotheken Umschau - https://www.apotheken-umschau.de/diagnose/laborwerte/ldl-cholesterin-risikofaktor-fuer-gefaesse-738277.html
Erhöhte Cholesterinwerte: Was sind die Ursachen? - Stiftung Gesundheitswissen - https://www.stiftung-gesundheitswissen.de/erhoehte-blutfette/cholesterinwerte
HDL-Cholesterin: Werte sollten nicht zu niedrig sein | Apotheken Umschau - https://www.apotheken-umschau.de/diagnose/laborwerte/hdl-cholesterin-werte-sollten-nicht-zu-niedrig-sein-736091.html
Hohes Cholesterin? Statine senken Cholesterinwerte zuverlässig - Deutsche Herzstiftung - https://herzstiftung.de/ihre-herzgesundheit/gesund-bleiben/cholesterin/cholesterin-statine
LDL-Cholesterin – kausale Rolle in der Atherogenese - https://www.ldl-senken.de/fachkreise/ldl-atherogenese
Atherosklerose - Herz-Kreislauf-Krankheiten - MSD Manual Profi-Ausgabe - https://www.msdmanuals.com/de/profi/herz-kreislauf-krankheiten/arteriosklerose/atherosklerose
Triglyzeride: Wert sollte nicht zu hoch sein | Apotheken Umschau - https://www.apotheken-umschau.de/diagnose/laborwerte/triglyceride-wert-sollte-nicht-zu-hoch-sein-740053.html
MODUL 6 Triglyzeride – Aktuelle Bewertung als Risikomarker und Therapieziele - https://www.dach-praevention.eu/wp-content/uploads/2022/10/Uebersichtsartikel_Modul-6.pdf
Blutfette (Cholesterin) - Schweizerische Herzstiftung - https://swissheart.ch/so-bleiben-sie-gesund/gesund-leben/blutfette
Lipoprotein(a): Ein „übersehener“ Risikofaktor - Trillium-Verlag - https://www.trillium.de/zeitschriften/trillium-diagnostik/trillium-diagnostik-ausgaben-2024/td-heft-4/2024-haematoonkologie/in-vitro-diagnostik/lipoproteina-ein-uebersehener-risikofaktor.html
Lipoprotein- Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall - lunow.de - https://www.lunow.de/diagnose/cholesterin/lipoprotein-a
Wann schaden Eier der Gesundheit? - Forschung & Lehre - https://www.forschung-und-lehre.de/forschung/wann-schaden-eier-der-gesundheit-1696
Für Patienten*innen - Deutsche Gesellschaft für Lipidologie e. V. (DGFL) - Lipid-Liga - https://www.lipid-liga.de/fuer-patienteninnen/
Gut essen und trinken – die DGE-Empfehlungen - http://www.dge.de/gesunde-ernaehrung/gut-essen-und-trinken/dge-empfehlungen/
Cholesterinspiegel senken - Deutsche Herzstiftung - https://herzstiftung.de/ihre-herzgesundheit/gesund-bleiben/cholesterin/cholesterinspiegel-senken
Auffällige Cholesterinwerte - www.cholesterinspiegel.de - https://www.cholesterinspiegel.de/auffaellige-cholesterinwerte/
Cholesterinsenker: Das sollten Sie über die medikamentöse Therapie wissen - https://www.cholesterin-neu-verstehen.de/cholesterin-senken/medikamente











































































































Kommentare