Allerheiligen als Feiertag: Heiligkeit, Erinnerung – und was das Gesetz dazu sagt
- Benjamin Metzig
- 1. Nov. 2025
- 6 Min. Lesezeit

Allerheiligen ist vieles zugleich: Hochfest der römisch-katholischen Kirche, kultureller Fixpunkt im Spätherbst, rechtlich besonders geschützter „stiller Feiertag“ in Teilen Deutschlands. Doch warum steht am 1. November die Heiligkeit im Mittelpunkt, während am 2. November (Allerseelen) die Verstorbenen der eigenen Familie ins Zentrum rücken? Und wieso zünden Menschen Kerzen auf Gräbern oft schon an Allerheiligen an – obwohl das theologisch eher zu Allerseelen gehört? In diesem Beitrag führen wir dich durch Theologie, Geschichte, Brauchtum und deutsches Feiertagsrecht – und zeigen, wie sich aus all dem ein erstaunlich modernes Kulturmosaik ergeben hat.
Wenn dich solche tiefen, verständlich erzählten Einblicke in Glauben, Gesellschaft und Recht begeistern, abonniere gern unseren monatlichen Newsletter – so verpasst du keinen neuen Beitrag mehr.
Was Allerheiligen eigentlich feiert – und was nicht
Allerheiligen ist ein Hochfest, also eine Feier höchsten liturgischen Ranges. Es bündelt einen großen Gedanken: die Kirche dankt für alle Heiligen – nicht nur für die offiziell kanonisierten, sondern ausdrücklich auch für die „Unbekannten“, deren Namen außer Gott niemand kennt. Das ist, wenn man so will, eine „Demokratisierung“ der Heiligkeit: Nicht nur Wunderberichte und kanonische Prozesse machen jemanden bedeutsam, sondern auch das stille, vorbildliche Leben im Alltag. Die Liturgie setzt so einen Kontrapunkt zum Eindruck, Heiligkeit sei eine elitäre Spitzendisziplin.
Wichtig ist die theologische Trennlinie zum Folgetag: Allerheiligen (1. November) feiert die bereits in Gottes Gegenwart vollendeten Menschen – die „ecclesia triumphans“. Allerseelen (2. November) dagegen ist der Tag der Fürbitte für die Verstorbenen, die nach katholischem Verständnis noch der Läuterung bedürfen – die „ecclesia patiens“. Zwei Tage, zwei Akzente – und doch werden ihre Bräuche im Alltag oft vermischt. Warum? Dazu gleich mehr.
Von Rom bis heute: Wie aus einem Märtyrergedächtnis ein globales Fest wurde
Die historische Spur führt in den christlichen Orient des 4. Jahrhunderts. Nach den Verfolgungen gab es so viele Märtyrer, dass der Kalender nicht für alle Einzelgedenktage ausreichte. Die Lösung: ein Sammelfest für alle Heiligen. Die Ostkirchen feiern es bis heute am ersten Sonntag nach Pfingsten – ein schöner Beleg, dass Feste wandern können, ohne ihren Kern zu verlieren.
In der Westkirche markiert das Jahr 609 n. Chr. eine Zäsur: Papst Bonifaz IV. weiht das römische Pantheon – ehemals „allen Göttern“ gewidmet – zu einer Kirche „der Mutter Gottes und aller Märtyrer“. Es ist die architektonische Übersetzung dessen, was die Liturgie macht: Bedeutungen überschreiben, ohne die Geschichte zu tilgen.
Auf den 1. November fällt Allerheiligen in Rom zunächst unter Gregor III., der eine Petersdom-Kapelle „allen Heiligen“ weiht. Gregor IV. weitet dieses Datum im 9. Jahrhundert auf die gesamte Westkirche aus. Vermutlich ist das kein Zufall: Der Termin liegt nahe an keltischen und germanischen Übergangsfesten wie Samhain – ein klassisches Beispiel für Inkulturation. Christliche Feste kleben sich gewissermaßen an vorhandene Zeitfenster, um sie neu zu deuten, statt sie krampfhaft zu ersetzen.
Allerseelen kommt erst später hinzu: 998 n. Chr. führt Abt Odilo von Cluny den Gedenktag für alle Verstorbenen ein. Theologisch spiegelt das die wachsende Bedeutung der Lehre vom Purgatorium im Hochmittelalter wider – und schafft ein eigenes liturgisches Zuhause für die Fürbitte.
Brauchtum im echten Leben: Warum der Friedhof am 1. November voll ist
Hier wird es spannend: In der religiösen Praxis verschmelzen Allerheiligen und Allerseelen – obwohl die Theologie sie klar trennt. Der Hauptgrund ist kein Dogma, sondern das deutsche Feiertagsrecht. Allerheiligen ist in mehreren, historisch katholisch geprägten Bundesländern ein gesetzlicher Feiertag – Allerseelen ist es nicht. Familien haben also am 1. November Zeit, Gräber zu schmücken, Kerzen zu entzünden und gemeinsam zu gedenken.
Der Gräberbesuch folgt einem spürbaren Symbolcode:
Blumen und Gestecke stehen für Liebe, Treue und Verbundenheit über den Tod hinaus.
Immergrün – Tanne, Buchs, Efeu – signalisiert Hoffnung und ewiges Leben.
Lichter – oft „Seelenlichter“ genannt – bilden das stärkste Zeichen. In der Dämmerung wird der Friedhof zum Meer aus kleinen Ewigen Lichtern. Wer je dort stand, kennt diese Mischung aus Wehmut und Trost.
Nicht selten findet am Nachmittag die Gräbersegnung statt: Andacht, biblische Lesungen, Gebete, Prozession zwischen den Gräbern. Weihwasser erinnert an die Taufe – eine symbolische Brücke vom Anfang des Christenlebens bis zur Vollendung. Weihrauch, Vaterunser und Gegrüßet seist du Maria rahmen die Hoffnung, dass Gott das begonnene Werk vollendet. Man könnte sagen: Die Liturgie denkt den Lebensbogen zu Ende.
Und dann ist da noch die süße Seite des Tages: der Allerheiligenstriezel – ein geflochtener Briochezopf, in Teilen Bayerns und Österreichs ein Patengeschenk an die Patenkinder. Ritual schmeckt eben manchmal nach Hefe, Wärme und Hagelzucker.
Allerheiligen als Feiertag im Kalenderkonzert: Halloween und Reformationstag
Der 1. November steht im deutschen Kulturkalender an einer Schnittstelle. Am Vorabend ist Halloween, dessen Name von „All Hallows’ Eve“ – dem Vigilabend vor Allerheiligen – stammt. Das heutige Grusel-Event hat sich weitgehend von seinen religiösen Wurzeln gelöst. In stark katholischen Regionen bleibt es oft Beiwerk; der ernsthafte Gedenktag ist und bleibt Allerheiligen.
Gleichzeitig markiert der 31. Oktober in vielen evangelisch geprägten Ländern den Reformationstag. Ergebnis: eine Feiertagsgrenze quer durch Deutschland. Während in Bayern, Baden-Württemberg, NRW, Rheinland-Pfalz und dem Saarland Allerheiligen arbeitsfrei ist, gilt der Reformationstag in zahlreichen nördlichen und östlichen Ländern. Diese Linie spiegelt die Konfessionsgeografie seit dem 16. Jahrhundert – Politik im Kalenderformat.
Still, aber nicht stumm: Was das Feiertagsrecht wirklich regelt
In den fünf genannten Bundesländern ist Allerheiligen nicht nur arbeitsfrei, sondern auch als stiller Feiertag besonders geschützt. Was heißt das konkret? Der Staat schützt den „ernsten Charakter“ des Tages im öffentlichen Raum – nicht die private Religionsausübung (die ohnehin grundgesetzlich gesichert ist), sondern die Atmosphäre. Das geschieht durch zeitlich begrenzte Verbote, typischerweise am Vormittag und Nachmittag.
Beispiel Nordrhein-Westfalen: Zwischen 5:00 und 18:00 Uhr sind u. a. öffentliche Tanzveranstaltungen untersagt. Auch laute Unterhaltungs-Events, Volksfeste, Zirkusaufführungen, bestimmte Märkte, Sportereignisse oder der Betrieb von Spielhallen sind in dieser Schutzzeit nicht erlaubt. Juristisch ist das ein bewusster Eingriff in Gewerbe- und Handlungsfreiheit – politisch ein Kompromiss zwischen Tradition und Pluralismus. Abends darf dann wieder getanzt werden; tagsüber hat der öffentliche Raum eine Atempause.
Vielleicht hilft ein Bild aus der Physik: Ein „Fenster-Filter“. Nicht alles wird blockiert, aber bestimmte Frequenzen – Party, Spektakel, Show – werden für ein paar Stunden herausgefiltert, damit leise Töne von Erinnerung, Trauer und Dank hörbar bleiben.
Fallstudie Soest: Die Allerheiligenkirmes – Widerspruch oder gutes Timing?
Wer „stiller Feiertag“ und „größte Altstadt-Kirmes Europas“ in einem Atemzug hört, denkt womöglich an Behördenzauber. Doch das Paradoxon löst sich zeitlich auf: Die Soester Allerheiligenkirmes beginnt stets am ersten Mittwoch nach dem 1. November und läuft fünf Tage bis Sonntag. An Allerheiligen selbst bleibt es ruhig; erst danach verwandelt sich die Altstadt in ein buntes Volksfest mit Pottmarkt, Fahrgeschäften und lokalen Kultgetränken wie „Bullenauge“ und „Dudelmann“.
Historisch wurzelt die Kirmes in der Kirchweih der St.-Petri-Kirche (urkundlich 1338). Der Name hält die religiöse Herkunft wach, auch wenn das Fest heute vor allem städtische Identität, Ökonomie und Geselligkeit feiert. Kultur kann eben beides: gedenken – und feiern. Nur nicht gleichzeitig am stillen Tag.
Ein Fest mit Janus-Gesicht – und warum das wichtig ist
Fasst man die Fäden zusammen, zeigt sich Allerheiligen als Janus-Gesicht der deutschen Kultur. Nach innen: ein stiller, familiärer Tag der Einkehr, liturgisch verankert und rechtlich geschützt. Nach außen: ein Knotenpunkt im Kalenderstreit zwischen Halloween-Popkultur und Reformationsgedächtnis – sowie Namensgeber großer Volksfeste, die bewusst erst nach der Stille beginnen.
Interessant ist, wie Theologie, Volksfrömmigkeit, Recht und Alltag sich gegenseitig formen. Die Theologie markiert sauber die Grenze zwischen Heiligenfest und Fürbittag. Die Volksfrömmigkeit verschiebt Bräuche pragmatisch auf den arbeitsfreien Tag. Das Recht schützt die Stille zeitlich begrenzt. Und die Kultur baut darum herum Rituale, Rezepte und Feste, die Generationen verbinden – vom Seelenlicht bis zum Striezel.
Vielleicht liegt darin die eigentliche Pointe von Allerheiligen als Feiertag: Es ist kein Museumsstück, sondern ein lernfähiges System. Es erinnert uns daran, dass Tradition nicht im Widerspruch zur Moderne stehen muss, solange wir klug mit Zeitfenstern, Symbolen und Rücksicht umgehen. Oder anders gefragt: Welche anderen Tage unseres Jahres könnten an Tiefe gewinnen, wenn wir ihnen ab und zu ein paar Stunden verordnete Langsamkeit gönnen?
Wenn dir dieser Blick hinter die Kulissen von Theologie, Geschichte, Brauchtum und Recht gefallen hat, gib dem Beitrag gern ein Like und teile deine Gedanken in den Kommentaren. Für mehr solcher Inhalte folge unserer Community auch auf Social Media:
#Allerheiligen #Allerseelen #StillerFeiertag #Feiertagsrecht #Brauchtum #Kirchenjahr #Halloween #Reformationstag #Kulturgeschichte #Rituale
Quellen:
Unterschied Allerheiligen/Allerseelen – t-online.de – https://www.t-online.de/leben/familie/familie-und-beruf/id_60290434/allerheiligen-und-allerseelen-der-unterschied-zwischen-den-feiertagen.html
Allerheiligen Feiertag – Ursprung & Bedeutung (Jakobsweg-Lebensweg) – https://jakobsweg-lebensweg.de/allerheiligen-feiertag/
Allerheiligen – Wikipedia – https://de.wikipedia.org/wiki/Allerheiligen
Allerheiligen & Allerseelen für Kinder erklärt – katholisch.de – https://www.katholisch.de/artikel/15269-allerheiligen-allerseelen-feiertag-november-erklaert-fuer-kinder
Was sind Allerheiligen und Allerseelen? – urnengeschaeft.de – https://www.urnengeschaft.de/blog/post/was-sind-allerheiligen-und-allerseelen-der-unterschied.html
Ursprung von Allerheiligen – Bauernzeitung – https://bauernzeitung.at/artikel/bundesteil/allerheiligen
Lichter für die Toten – katholisch.de – https://www.katholisch.de/artikel/167-lichter-fur-die-toten
Bedeutung von Allerheiligen – Hofer-Kerzen – https://www.hofer-kerzen.at/blog/die-bedeutung-von-allerheiligen-und-allerseelen-was-wird-da-eigentlich-gefeiert
„Lichter und Strietzl“ – Diözese Innsbruck – https://www.dibk.at/meldungen/Lichter-und-Strietzl-Allerheiligen-und-alles-drum-herum
Allerheiligen – Allerseelen – Deutsche Bischofskonferenz – https://www.dbk.de/themen/allerheiligen-allerseelen
Geschichte & Brauchtum (Österreich) – feiertage-oesterreich.at – https://www.feiertage-oesterreich.at/allerheiligen-1-november/
Allerheiligen: Stiller Feiertag – Hellweg Radio – https://www.hellwegradio.de/artikel/allerheiligen-stiller-feiertag-und-totengedenken-1472185.html
Gräberbesuch am 1. November – Katholische Kirche Stuttgart – https://www.kath-kirche-stuttgart.de/service/journal/detail/viele-menschen-besuchen-am-1-november-die-geschmueckten-graeber-ihrer-angehoerigen
Allerheiligen in Oberbayern – Zwergerl Magazin – https://zwergerl-magazin.de/RundumFamilie/brauchtum-tradition/allerheiligen-in-oberbayern/
Segnung der Gräber (Kärnten, PDF) – https://www.kath-kirche-kaernten.at/images/downloads/allerheiligen--segnung-der-graeber.pdf
Gräbersegnung (Seelsorge Regensburg, PDF) – https://seelsorge-regensburg.de/wp-content/uploads/2024/09/Graebersegnung2024.pdf
Andacht zur Gräbersegnung (Bistum Hildesheim, PDF) – https://www.bistum-hildesheim.de/fileadmin/dateien/PDFs/Gottesdiensthilfen/hausgottesdienste/WGF_Lj_A_Allersl_-_2020-11-02_Graebersg.pdf
Allerheiligen – Brauch (OÖ-Brauchtumskalender) – http://www.brauchtumskalender.at/brauch-21-allerheiligen
Allerheiligen – Feiertag in Deutschland – https://www.feiertage-deutschland.de/allerheiligen/
Halloween: Herkunft des Namens – Wikinger-Reisen Blog – https://www.wikinger-reisen.de/blog/halloween-allerheiligen-dia-de-los-muertos/
Halloween – Wikipedia – https://de.wikipedia.org/wiki/Halloween
Reformationstag oder Allerheiligen? – JOYN Newstime – https://newstime.joyn.de/themen/panorama/reformationstag3110-oder-allerheiligen111-in-welchem-bundesland-ist-heute-frei-feiertag-14179
Reformationstag versus Allerheiligen – DOMRADIO.DE – https://www.domradio.de/glossar/reformationstag-versus-allerheiligen
Regeln in Weiden (Beispiel) – weiden24.de – https://weiden24.de/das-gilt-an-allerheiligen-in-weiden/cnt-id-ps-fedb3be1-bc91-4f1e-9faa-117ca4775677
Katholische Kantone/CH – Wikipedia-Abschnitt – https://de.wikipedia.org/wiki/Allerheiligen#:~:text=In%20den%20katholisch%20gepr%C3%A4gten%20Kantonen
Regeln für Veranstaltungen in NRW – Radio Erft – https://www.radioerft.de/artikel/allerheiligen-regeln-fuer-veranstaltungen-in-nrw-2482087.html
Ursprung & Bräuche – Erzbistum Köln – https://www.erzbistum-koeln.de/presse_und_medien/magazin/Feiertag-Allerheiligen-Ursprung-und-Braeuche-am-1.-November/
Sonn- und Feiertagsgesetz NRW – IHK Köln – https://www.ihk.de/koeln/hauptnavigation/recht-steuern/sonn-und-feiertagsgesetz-nrw-5224680
„Stille Feiertage“ besonders geschützt – Kreis Paderborn – https://www.kreis-paderborn.de/kreis_paderborn/aktuelles/pressemitteilungen/2018/allerheiligen-volkstrauertag-und-totensonntag-als-stille-feiertage-besonders-geschuetzt.php
Stille Feiertage – Stadt Essen – https://www.essen.de/leben/sicherheit_und_ordnung/stille_feiertage__uebersicht.de.html
Regeln an stillen Feiertagen – Serviceportal Stadt Bielefeld – https://service.bielefeld.de/detail/-/vr-bis-detail/dienstleistung/8845/show
SGV NRW §6 Stille Feiertage – https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_detail?bes_id=3367&anw_nr=2&aufgehoben=N&det_id=144449
Stiller Feiertag: Das ist in Köln verboten – https://www.koeln.de/aktuelles/stiller-feiertag-das-ist-an-allerheiligen-verboten-79861/
Stille Feiertage im November – Stadt Köln – https://www.stadt-koeln.de/politik-und-verwaltung/presseservice/stille-feiertage-im-november-2025
Feiertagsregelungen Düsseldorf – https://www.duesseldorf.de/ordnungsamt/gewerbe/feiertage1
Allerheiligenkirmes – Wikipedia – https://de.wikipedia.org/wiki/Allerheiligenkirmes
Allerheiligenkirmes – Stadt Soest – https://www.soest.de/politik-verwaltung/dienstleistungen-a-z/allerheiligenkirmes
Soester Veranstaltungskalender – https://kalender-soest.de/?dfxid=42873
Soester Allerheiligenkirmes 2025 – Volksbank Hellweg eG – https://www.volksbank-hellweg.de/meine-bank/veranstaltungen/allerheiligenkirmes.html












































































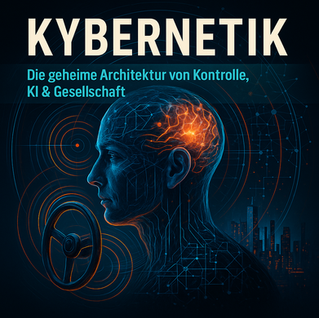

















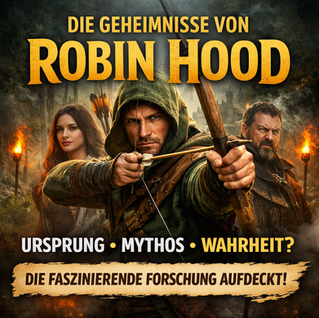





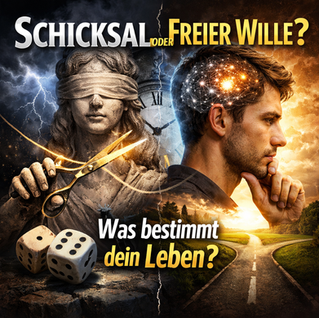






Kommentare