Opferrollen, Erinnerungspolitik und das Ungleichgewicht globaler Empathie
- Benjamin Metzig
- 11. Okt. 2025
- 5 Min. Lesezeit

Ein Gastbeitrag von Michael Stricker
Eine vergleichende Analyse israelisch-jüdischer und globaler Konfliktnarrative
Die Wahrnehmung von Leid, historischer Verantwortung und Schuld ist ein zentraler Bestandteil kollektiver Erinnerungskulturen und politischer Legitimation. In modernen Gesellschaften prägen Opferrollen nicht nur die moralische Bewertung vergangener Ereignisse, sondern auch gegenwärtige politische Handlungsspielräume. Insbesondere die jüdisch-israelische Geschichte wird in westlichen Diskursen häufig in einer spezifischen moralischen Rahmung verhandelt: als fortwährende Erinnerung an die Shoah und als Grundlage eines besonderen Schutzes gegenüber antisemitischen Bedrohungen.
Diese Erinnerung ist zweifellos gerechtfertigt. Doch die Art und Weise, wie sie gesellschaftlich und politisch instrumentalisiert wird, wirft Fragen auf. So hat sich im kollektiven Bewusstsein vieler westlicher Staaten ein nahezu sakrosanktes Bild jüdischen Leids verfestigt, das jede Form von Kritik an israelischer Realpolitik – etwa im Kontext des Gaza-Konflikts – reflexhaft in die Nähe des Antisemitismus rückt. Dies erschwert eine nüchterne, faktenbasierte und moralisch ausgewogene Betrachtung.
Gleichzeitig finden andere humanitäre Katastrophen – wie jene im Jemen, Sudan, der Demokratischen Republik Kongo, gegen die Rohingya in Myanmar oder gegen die Uiguren in China – deutlich weniger internationale Beachtung, obwohl sie in Umfang, Brutalität und Leid vielfach die Zahl der Opfer übersteigen. Dieses Ungleichgewicht verweist auf ein globales Defizit kollektiver Empathie, das nicht primär auf moralische, sondern auf politische und historische Machtstrukturen zurückzuführen ist.
Historische Genese der jüdischen Opferrolle
Die jüdische Geschichte ist seit der Antike von Vertreibung, Diskriminierung und Pogromen geprägt. Spätestens mit der Shoah im 20. Jahrhundert erreichte dieses Leid einen Zivilisationsbruch, der als einmalig gilt. Die Vernichtung von sechs Millionen europäischen Juden während des Nationalsozialismus stellte nicht nur eine menschliche Tragödie dar, sondern auch eine moralische Zäsur, die das Fundament moderner Erinnerungspolitik in der westlichen Welt bildet¹.
In Folge des Zweiten Weltkrieges entwickelte sich die Opferrolle des jüdischen Volkes zu einer kollektiven Identitätskomponente. Diese Rolle wurde in Israel zu einem politischen Instrument, das sowohl die nationale Einheit stärkt als auch außenpolitische Rückendeckung – insbesondere durch westliche Staaten – sichert².
Realpolitische Transformation: Vom Opfer zur Machtposition
Mit der Gründung des Staates Israel 1948 vollzog sich ein Paradigmenwechsel: Aus einem jahrtausendelangen Opferkollektiv entstand ein souveräner Nationalstaat mit einer der modernsten Armeen der Welt. Diese Transformation führte zu einem Spannungsverhältnis zwischen moralischer Selbstverortung als Opfer und realpolitischem Agieren als Machtstaat.
Insbesondere seit den 1967 begonnenen Besatzungen und der fortschreitenden Siedlungspolitik im Westjordanland, in Ostjerusalem und im Gaza-Konflikt steht Israel international in der Kritik. Während israelische Sicherheitsinteressen – vor dem Hintergrund traumatischer historischer Erfahrungen – nachvollziehbar sind, führt die militärische Überlegenheit zu asymmetrischen Konflikten, deren Opferbilanz zunehmend die Zivilbevölkerung betrifft³.
Die Diskrepanz zwischen historischem Selbstverständnis und gegenwärtiger Politik nährt den Vorwurf, Israel agiere aus einer „historisch verbrieften Immunität“ heraus – ein Privileg, das anderen Staaten in vergleichbaren Konflikten nicht zugestanden wird.
Aufarbeitung und Selbstkritik in der israelischen Gesellschaft
Die israelische Gesellschaft ist pluralistisch, doch die Diskurse über eigene Schuldanteile oder mögliche Kriegsverbrechen sind marginalisiert. Zwar existieren kritische Stimmen – etwa von Organisationen wie Breaking the Silence, die Aussagen israelischer Soldaten dokumentieren⁴ – doch sie stehen gesellschaftlich und politisch unter Druck.
Die Mehrheit der israelischen Bevölkerung betrachtet militärische Maßnahmen im Gazastreifen als notwendig, um die eigene Sicherheit zu gewährleisten. Zivile Opfer werden vielfach als unvermeidbare Kollateralschäden verstanden. Eine tiefgreifende öffentliche Debatte über moralische Verantwortung oder die langfristigen Folgen einer Dauerbesatzung bleibt aus – nicht zuletzt, weil die historische Erinnerung an die eigene Verfolgung jede Gleichsetzung mit Tätern moralisch infrage stellt⁵.
Diese fehlende Aufarbeitung hat zur Folge, dass die israelische Gesellschaft in Teilen geschichtsvergessen gegenüber den Dynamiken geworden ist, die einst das eigene Leid verursacht haben.
Geschichtsvergessenheit und kollektive Narrative
Das israelische Selbstverständnis beruht auf einem spezifischen Narrativ: Israel als „ewiges Opfer“, bedroht von äußeren Feinden. Dieses Narrativ prägt Bildung, Medien und politische Rhetorik. Gleichzeitig wird die Verantwortung für das Leid anderer – insbesondere der Palästinenser – selten thematisiert.
Die Verknüpfung religiöser, kultureller und historischer Narrative erzeugt eine „moralische Immunität“, die jede Selbstkritik als Verrat an der nationalen Identität erscheinen lässt. Dies verhindert eine kritische Reflexion über den Umgang mit Macht, Gewalt und Verantwortung – Aspekte, die für eine demokratische Gesellschaft zentral wären⁶.
Internationale Wahrnehmung und mediale Fokussierung
Die mediale Aufmerksamkeit für jüdisches Leid ist historisch bedingt und wird durch westliche Erinnerungspolitiken verstärkt. Antisemitismus gilt als moralischer Prüfstein der westlichen Zivilisation, während koloniale oder gegenwärtige postkoloniale Gewaltformen in Afrika oder Asien selten denselben moralischen Nachhall erzeugen⁷.
Die selektive Empathie erklärt sich weniger aus moralischer Gewichtung, sondern aus politischer Nähe: Israel gilt als westlicher Verbündeter, während Konflikte in Subsahara, Afrika oder Asien meist außerhalb der strategischen Interessen liegen. Das resultierende Schweigen zu millionenfachem Leid ist Ausdruck einer globalen Doppelmoral.
Vergleich mit anderen humanitären Katastrophen
Im Jemen-Konflikt sind seit 2015 über 377.000 Menschen durch Krieg, Hunger und Krankheit ums Leben gekommen⁸. In der Demokratischen Republik Kongo fielen seit den 1990er Jahren über fünf Millionen Menschen den Konflikten um Ressourcen zum Opfer⁹. Die Rohingya in Myanmar wurden systematisch vertrieben und ermordet, über eine Million Menschen leben in Flüchtlingslagern¹⁰. In China sind Schätzungen zufolge über eine Million Uiguren in Umerziehungslagern interniert¹¹.
Diese Beispiele zeigen: Die moralische Gewichtung von Leid korreliert nicht mit dessen Ausmaß, sondern mit geopolitischer Sichtbarkeit. Jene, die über keinen medialen, wirtschaftlichen oder politischen Einfluss verfügen, bleiben Opfer zweiter Ordnung.
Strukturelle Ursachen selektiver Empathie
Das globale Empathiegefälle ist strukturell bedingt:
Mediale Infrastruktur: Staaten mit freier Presse und westlicher Vernetzung
dominieren Diskurse.
Kulturelle Nähe: Der Westen empfindet stärkeres Mitgefühl für Kulturen, die ihm ähnlicher erscheinen.
Politische Allianzen: Humanitäres Interesse wird dort geweckt, wo geopolitische Interessen tangiert sind.
Moralische Hierarchien: Der Holocaust als absolute moralische Referenz verdrängt andere Leidensnarrative in den Hintergrund.
Diese Faktoren führen dazu, dass jüdisches Leid universal erinnert, während andere Tragödien fragmentarisch wahrgenommen werden.
Schlussfolgerung
Die jüdisch-israelische Opferrolle ist historisch begründet und verdient Anerkennung. Doch ihre politische Instrumentalisierung und die mangelnde Selbstkritik innerhalb der israelischen Gesellschaft gefährden die moralische Glaubwürdigkeit dieses Narrativs. Gleichzeitig offenbart der globale Vergleich, dass Empathie nicht gerecht verteilt ist.
Opferstatus ist kein objektives moralisches Attribut, sondern Resultat von Macht, Erinnerung und medialer Sichtbarkeit. Eine gerechte Weltordnung erfordert die Gleichbehandlung allen menschlichen Leids – unabhängig von Religion, Ethnie oder geopolitischer Relevanz.
Quellen und Fußnoten
¹ European Union Agency for Fundamental Rights (FRA): Antisemitism – Overview of Antisemitic Incidents Recorded in the EU, 2024.
² Yad Vashem World Holocaust Remembrance Center: The Role of Memory in Israeli Statehood, 2023.
³ UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA): Occupied Palestinian Territory Humanitarian Needs Overview, 2024.
⁴ Breaking the Silence: Testimonies from Israeli Soldiers on Gaza Operations, 2023.
⁵ Israel Democracy Institute: Israeli Voice Index, Februar 2024.
⁶ Bar-Tal, D.: Intractable Conflicts and Societal Beliefs, Cambridge University Press, 2013.
⁷ Said, E.: Orientalism, Pantheon Books, 1978.
⁸ United Nations Development Programme (UNDP): Assessing the Impact of War in Yemen, 2022.
⁹ UN OHCHR: Report on the Situation of Human Rights in the DRC, 2023.
¹⁰ UNHCR: Myanmar Rohingya Emergency Overview, 2023.
¹¹ Human Rights Watch: China’s Crackdown on Xinjiang’s Muslims, 2023.




























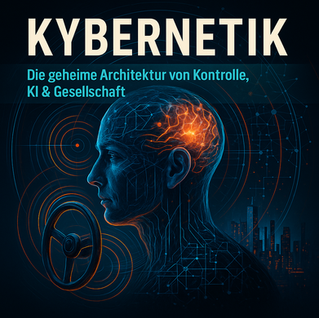

















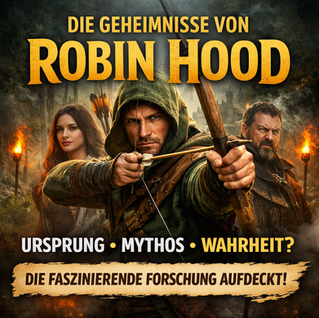





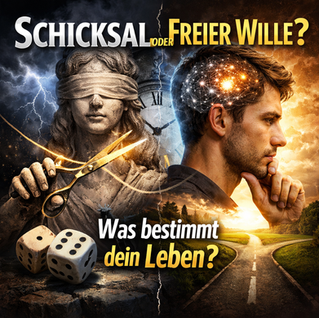









































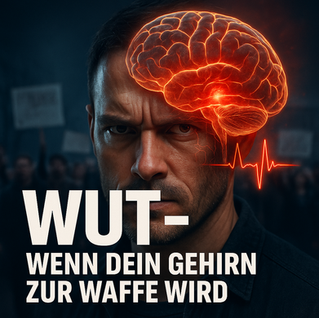












Kommentare