Synästhesie verstehen: Die Welt der verschmolzenen Sinne
- Benjamin Metzig
- 22. Okt. 2025
- 6 Min. Lesezeit

Du beißt in ein Stück Hähnchen und denkst: „Hmm, zu wenig … Spitzen?“ Genau so begann 1980 die moderne Wiederentdeckung der Synästhesie – als ein Neurologe über eine irritierende Bemerkung seines Dinnergasts stolperte und daraus eine Forschungswelle wurde. Seitdem ist klar: Für manche Menschen ist „Dienstag“ links vom Kopf, der Buchstabe „A“ knallrot, ein G-Akkord gelb, und der Name „Derek“ schmeckt tatsächlich nach – ja, Ohrenschmalz. Diese Berichte sind keine poetischen Metaphern, sondern konsistente, lebenslang stabile Wahrnehmungen, die sich im Gehirn messen lassen. Wenn dich solche Grenzgänge zwischen Sinn und Sinnlichkeit faszinieren, dann abonnier gern meinen monatlichen Newsletter für mehr solcher tiefen, aber gut verdaulichen Wissenschaftsreisen.
Synästhesie ist damit nicht Krankheit, nicht Halluzination, sondern eine natürlich vorkommende Variante menschlichen Bewusstseins – ein Fenster in die Mechanik unseres Denkens. Und genau dieses Fenster schauen wir heute weit auf: Was ist Synästhesie präzise? Wo im Gehirn verschaltet sie sich? Welche Formen gibt es, welche Stärken, welche Stolpersteine? Und warum wird sie inzwischen als Modellfall für das Verständnis von Bewusstsein und Neurodiversität gefeiert?
Synästhesie verstehen: Definition, Kernmerkmale und Typen des Erlebens
Der Begriff kommt aus dem Griechischen: syn (zusammen) und aisthesis (Empfindung). Gemeint ist eine automatische „Mitempfindung“: Ein Reiz in einem Kanal – etwa ein Buchstabe – löst unwillkürlich eine Wahrnehmung in einem anderen Kanal aus – etwa eine Farbe. Entscheidend ist die Automatik: Man kann sie nicht an- oder ausschalten, so wenig wie man die Schwerkraft steuern kann. Ebenso entscheidend ist die Konsistenz: Wer das „A“ als Rot erlebt, erlebt es morgen, nächstes Jahr und in zehn Jahren wieder als Rot. Diese Stabilität ist der Goldstandard, mit dem sich echte Synästhesie im Labor nachweisen lässt.
Spannend ist auch die räumliche Qualität. Manche erleben die Zusatzwahrnehmung „im Kopf“, andere sehen sie außen „im Raum“. Diese Unterscheidung – Assoziierer versus Projektoren – deutet auf unterschiedliche Ebenen der Verarbeitung hin. Bei Assoziierern scheint die Verknüpfung später, eher konzeptuell zu passieren („das Konzept A“ koppelt an „Rot“). Bei Projektoren scheint sie früher in der visuellen Pipeline zu feuern – nahe an Arealen, die Formen und Farben kodieren. Kurz: Synästhesie ist keine monolithische Sache, sondern eine Familie von Mechanismen entlang der Wahrnehmungshierarchie.
Wie verbreitet ist das? Moderne Schätzungen liegen bei etwa 4–5 % der Bevölkerung, mit deutlicher familiärer Häufung. Das macht Synästhesie nicht selten, eher „versteckt häufig“ – viele merken erst spät, dass ihr Erleben anders ist, weil ihnen schlicht der Vergleich fehlt. In Künstlerkreisen ist sie überrepräsentiert, was uns glatt zur nächsten Frage bringt: Was macht sie mit Kognition und Kreativität?
Das Gehirn auf Lautsprecher-Modus: Was die Neurowissenschaft über die Sinnesfusion zeigt
Bildgebende Verfahren wie fMRT haben das Subjektive objektiviert. Wenn ein Graphem-Farb-Synästhetiker einen schwarzen Buchstaben sieht, leuchten nicht nur Formareale, sondern auch Farbareale (rund um V4) auf. Das ist kein „Als-ob“, sondern messbare Koaktivität. DTI-Studien – sie kartieren weiße Faserbahnen – zeigen zusätzlich: In Gehirnen von Synästhetiker*innen findet sich häufig eine erhöhte strukturelle Vernetzung zwischen relevanten Arealen. Man kann es sich vorstellen wie Städte (Areale), zwischen denen die Autobahnen dichter und direkter ausgebaut sind.
Dazu kommen zwei komplementäre Erklärungslinien. Erstens die Kreuzaktivierungshypothese: In der Entwicklung bleiben mehr „Querverbindungen“ erhalten (Stichwort: unvollständiges synaptisches Pruning). Zweitens die Hypothese der disinhibierten Rückkopplung: Die Verbindungen sind grundsätzlich da – bei allen –, werden aber normalerweise gehemmt; fällt Hemmung weg (durch Genetik, Zustände, teils auch Psychedelika), „übersprechen“ die Sinne. Beide Modelle schließen sich nicht aus. Genetik liefert die Grundlage – und tatsächlich zeigen Familienstudien Anreicherungen in Genen, die Axonwachstum und Zellmigration betreffen. Mit anderen Worten: Die Verkabelung selbst trägt den Fingerabdruck der Synästhesie.
Wenn du bis hier neugierig genickt hast: Lass ein Like da und sag mir unten in den Kommentaren, welche Form dich am meisten verblüfft!
Formenreichtum ohne Ende: Von farbigen Buchstaben bis schmeckenden Wörtern
Über 80 Varianten sind dokumentiert – ein Kaleidoskop der Wahrnehmung. Einige der prominentesten:
Graphem-Farb-Synästhesie: Buchstaben/Zahlen besitzen inhärente Farben. Häufigkeit: etwa 1–2 %. Praktischer Nebeneffekt: Telefonnummern oder Passwörter lassen sich als Farbreihen leichter merken.
Chromästhesie (Hören-in-Farbe): Klänge erzeugen Farben, Formen, Bewegungsmuster. Viele Musiker*innen berichten, dass Akkorde und Timbres Farbpaletten „haben“.
Sequenz-Raum-Synästhesie: Wochentage, Monate, Jahreszahlen liegen als stabile räumliche Anordnung „im Raum“. Das wirkt wie ein eingebauter mentaler Kalender.
Lexikal-gustatorische Synästhesie: Wörter schmecken – teils mit verblüffender Spezifität. Haltestellen der U-Bahn, Namen von Menschen, Songtitel: alles kann Textur und Aroma bekommen.
Ordinal-linguistische Personifikation: Zahlen oder Monate haben Persönlichkeit und Geschlecht. Die „3“ ist vielleicht ein schrulliger Onkel; der Juni ein gemütlicher Freund.
Spiegel-Berührungs-Synästhesie: Wer Berührung bei anderen sieht, spürt sie am eigenen Körper. Extrem eindrücklich – und aufschlussreich für Empathie-Mechanismen.
Ticker-Tape-Synästhesie: Gesprochenes läuft als inneres Untertitelband mit – als hätte das Gehirn einen permanenten Teleprompter.
Auffällig ist, wie oft diese Erlebnisse alltagspraktisch werden: Farben helfen beim Buchstabieren, Räume sortieren Sequenzen, Geschmäcker „etikettieren“ Namen. Das Gehirn baut redundante Abrufpfade – und Gedächtnis dankt.
Kognitive Superpower? Vorteile, Herausforderungen und der Alltag mit Synästhesie
Beginnen wir mit den Good News. Viele Synästhetiker*innen berichten (und Studien stützen das): besseres Erinnern, wenn Inhalte an die jeweilige Mitempfindung gekoppelt sind; mehr Kreativität, weil das Gehirn ohnehin ständig Ungewöhnliches verknüpft; feinere Sinneswahrnehmung im Detail. Das ist keine Magie, sondern saubere Neurologik: Mehr Kodierung = mehr Abrufwege, ungewöhnliche Kopplungen = originelle Ideen.
Doch die Medaille hat eine Rückseite. Wo viel los ist – volle U-Bahn, grelle Mall, Konzerte – kann Reizüberflutung spürbar werden. Wenn jedes Wort schmeckt oder jeder Ton farbig „sprüht“, wird das Verarbeiten anstrengend. Manche erleben Ablenkbarkeit, weil die Mitempfindung Aufmerksamkeit zieht. Und lange fehlte vielen schlicht der Begriff für ihr Erleben – soziales Unverständnis war die Folge. Das ändert sich zum Glück rasant: Synästhesie wird heute als Teil der Neurodiversität verstanden – nicht als Defizit, sondern als gültige Art, Welt zu erleben.
Messen, nicht raten: Von Selbstbericht bis „Synesthesia Battery“
„Ich sehe das A rot“ – wie prüft man das wissenschaftlich? Der Klassiker ist der Konsistenztest. Man lässt Buchstaben-Farb-Zuordnungen mehrfach, zeitlich getrennt abfragen. Echte Synästhetiker*innen sind erstaunlich stabil; willkürliche Zuordnungen driften. Standardisierte Online-Suiten wie die Synesthesia Battery kombinieren Fragebögen mit präzisen Reaktions- und Farbabgleichstests und liefern so Vergleichswerte für Labore weltweit.
Doch Forschung bleibt selbstkritisch. Wird Konsistenz zu stark zum Torwächter, droht Zirkularität: Wer nur extrem Konsistente einschließt, „beweist“ am Ende, dass Synästhesie extrem konsistent ist. Neuere Arbeiten zeigen, dass es inkonsistente Synästhesie geben kann – Menschen, die Tests nicht bestehen, aber in Verhalten und Wahrnehmung klare synästhetische Signaturen zeigen. Die Lösung zeichnet sich ab: Multimodale Diagnostik, die harte Metriken (Konsistenz-Scores, Bildgebung) mit validierten, phänomenologischen Interviews verbindet. Das ist nicht nur fair gegenüber Vielfalt – es bringt uns näher an die Wissenschaft des Erlebens selbst.
Kunst, Sprache, Technologie: Synästhesie als Kulturtechnik
In der Kunstgeschichte ist Synästhesie ein heimlicher Co-Autor. Wassily Kandinsky übersetzte Töne in Farben und schuf so die Grammatik der abstrakten Malerei – Gelb wie Trompete, Dunkelblau wie Cello. In der Popmusik arbeiten Pharrell Williams, Billie Eilish, Lorde & Co. bewusst mit Farbpaletten, die Songs „haben“. Literatur? Vladimir Nabokov textete mit farbigen Buchstaben – und man spürt es zwischen den Zeilen.
Unsere Alltagssprache ist voll synästhetischer Metaphern: „schreiende Farben“, „süße Klänge“, „raue Stimme“. Der berühmte Bouba/Kiki-Effekt zeigt, dass selbst Nicht-Synästhetiker*innen systematisch Laute und Formen koppeln. Vielleicht ist Synästhesie also keine exotische Insel, sondern ein besonders sichtbarer Ausläufer einer grundmenschlichen Tendenz: Bedeutung sensorisch zu verankern.
Und Technologie? Systeme der sensorischen Substitution – Kamerabild wird zu Klanglandschaft – erlauben Blinden, durch Hören zu „sehen“. Man könnte sagen: künstlich erzeugte, absichtliche Synästhesie. Die Erfolge solcher Geräte sind Anschauungsunterricht in Gehirnplastizität – und ein starkes Argument, warum Synästhesie als Forschungsmodell so wertvoll ist.
Von „bunt“ zu bewusst: Was Synästhesie über das Denken verrät
Ein aufkommendes Konzept heißt Ideasthesie: Nicht Sinn zu Sinn wird verknüpft, sondern Bedeutung (idea) zu Sinn (aisthesis). Das erklärt, warum oft nicht der visuelle Reiz selbst, sondern sein Konzept triggert – etwa „Dienstag“ als Bedeutung, nicht nur als Wortform. Synästhesie rückt damit in die Nähe dessen, was alle Gehirne ständig tun: Abstraktes in Erlebbarkeit zu übersetzen.
Aktuelle Studien (2022–2024) schauen außerdem auf neurochemische Marker wie BDNF, der Wachstum und Plastizität fördert. Hypothese: Synästhetische Gehirne könnten länger oder anders „im Lernmodus“ bleiben – nicht regressiv, sondern hochdifferenziert. Parallel nutzt die Forschung Synästhesie als Werkzeug, um Sprache, Gedächtnis und multisensorische Integration bei allen Menschen besser zu verstehen. Kurz: Wer Sinnesfusion erforscht, landet mitten im Maschinenraum des Bewusstseins.
Verschmolzene Sinne als Einladung, Welt neu zu lesen
Synästhesie verstehen heißt, die Grenze zwischen meinen und deinen Sinnen, zwischen Sehen und Hören, zwischen Bedeutung und Gefühl zu hinterfragen. Sie zeigt, wie unser Gehirn subjektive Realität konstruiert – präzise, regelhaft und doch individuell. Und sie erinnert uns daran, dass Vielfalt im Erleben kein Randphänomen, sondern ein Grundprinzip ist.
Wenn dich dieses Thema genauso elektrisiert wie mich, folg der Community für mehr Wissenschaft, die knistert und trägt:
Hat dir der Artikel geholfen, Synästhesie zu verstehen? Dann like ihn gern und teile deine Gedanken, Fragen oder eigenen Erfahrungen in den Kommentaren. Ich lese mit – farbig versprochen.
Quellen:
Synästhesie – Wikipedia - https://de.wikipedia.org/wiki/Syn%C3%A4sthesie
A standardized test battery for the study of synesthesia (PMC) - https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4118597/
Synesthesia - Wikipedia (EN) - https://en.wikipedia.org/wiki/Synesthesia
Deutsche Synästhesie-Gesellschaft e.V. – Was ist Synästhesie? (wissenschaftliche Version) - https://www.synaesthesie.org/de/synaesthesie/was-ist-synaesthesie-wissenschaftliche-version
Personen-Lexikon | Deutsche Synästhesie-Gesellschaft e.V. - https://www.synaesthesie.org/de/personenlexikon
Die 25 häufigsten Formen der Synästhesie - https://synnie-info.de/die-25-haeufigsten-formen-der-synaesthesie/
Synästhesie: Farbwahrnehmung und Hirnforschung – dasGehirn.info - https://www.dasgehirn.info/wahrnehmen/truegerische-wahrnehmung/milde-musik-und-zickige-zahlen
Medienmitteilung: Wenn Buchstaben farbig werden – Universität Bern - https://mediarelations.unibe.ch/medienmitteilungen/archiv/2010/synaesthesie/index_ger.html
Klänge sehen: erste Hinweise auf molekulare Ursachen – Max-Planck-Gesellschaft - https://www.mpg.de/11966178/molekulare-hinweise-auf-synaesthesie
Synesthesia Battery | Home - https://synesthete.ircn.jp/
Tasty colorful sounds – APA Podcast mit Julia Simner - https://www.apa.org/news/podcasts/speaking-of-psychology/synesthesia
Synästhesie: Verschmolzene Sinne – Quarks (YouTube) - https://www.youtube.com/watch?v=MrwKxH-9pMs
Lexical-gustatory synesthesia – The Synesthesia Tree - https://www.thesynesthesiatree.com/2021/03/lexical-gustatory-synesthesia.html
Investigation of the relationship between neuroplasticity and grapheme-color synesthesia (PMC) - https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11366591/
How “diagnostic” criteria interact to shape synesthetic behavior – PubMed - https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39922140/
Synästhesie ± Zur kognitiven Neurowissenschaft des farbigen Hörens – Thieme Connect - https://www.thieme-connect.de/products/ejournals/pdf/10.1055/s-2001-18377.pdf
Synästhesie – Psychologisches Institut, Universität Zürich - https://www.psychologie.uzh.ch/de/institut/ueber-uns/angehoerige/emeriti/neuropsy/Forschung/KonkreteForschungsthemen/Synaesthesie.html
Der Klang der Farben – Google Arts & Culture - https://artsandculture.google.com/story/der-klang-der-farben/0ALymHuhPl1jLg?hl=de
10 Musiker*innen und wie sie Synästhesie nutzen - https://synnie-info.de/musiker-und-wie-sie-ihre-synaesthesie-nutzen/
Science in School: Gemischte Gefühle – Synästhesie verstehen - https://scienceinschool.org/de/article/2018/blended-senses-understanding-synaesthesia-de/
Studie: Auswirkungen von Synästhesie (Uni Bern, EdPer 2016) - https://www.kog.psy.unibe.ch/unibe/portal/fak_humanwis/philhum_institute/inst_psych/psy_kog/content/e48297/e48316/e702309/e756838/files756923/Meier_EdPer2016_ger.pdf
Karolinska Institutet – Synaesthesia, autism and perception - https://ki.se/en/research/research-areas-centres-and-networks/research-groups/synaesthesia-autism-and-perception-janina-neufelds-team






























































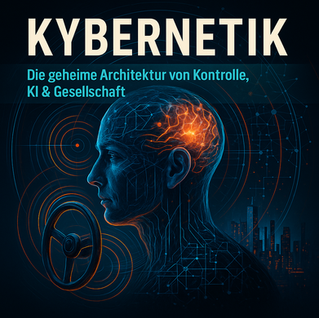

















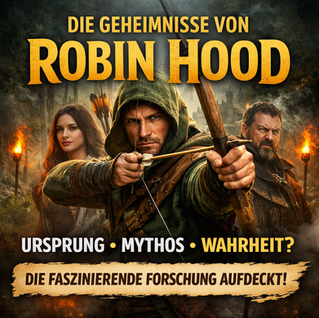





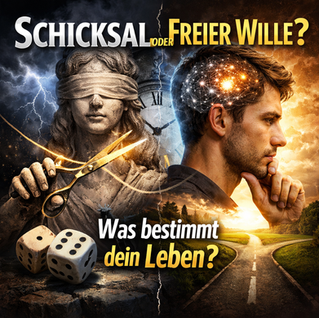




















Kommentare