Hic sunt dracones: Wie mittelalterliche Kartenmonster Wissen, Mythos und Macht ordneten
- Benjamin Metzig
- 8. Okt. 2025
- 5 Min. Lesezeit

Wer eine Weltkarte aus Mittelalter oder Früher Neuzeit betrachtet, blättert in einer Enzyklopädie aus Pergament: Schiffe kämpfen gegen Schlangenwesen, am Rand der Kontinente wohnen kopflose Krieger und hundsköpfige Völker, irgendwo in Indien ruht der Skiapode unter seinem riesigen Fuß wie unter einem Sonnenschirm. Was für moderne Augen wie dekorative Randnotizen wirkt, war einmal ernst gemeinte Welterklärung. Karten waren keine neutralen Navigationshilfen, sondern Bilderzählungen, die Wissen, Glauben und Politik verknüpften – und die „Monster“ gehörten zwingend dazu.
Wenn dich solche Deep Dives in historische Wissenschaftskulturen faszinieren, abonnier gern meinen monatlichen Newsletter für mehr fundierte, staunenswerte Longreads.
Die Logik der mittelalterlichen Kartenmonster
Warum füllten Kartograph:innen die Ränder der Ökumene mit Fabelvölkern? Weil „Wissenschaft“ im Mittelalter nicht exklusiv empirisch war, sondern das gesamte verfügbare Wissen integrierte – Bibel, antike Autoren, Reiseberichte, Gelehrsamkeit. Plinius der Ältere und Solinus galten als Autoritäten, nicht als Anekdotenlieferanten. Wer also Blemmyer (Kopflose mit Gesicht auf der Brust), Kynokephale (Hundsköpfige) oder die mundlosen Astomi einzeichnete, kopierte nicht Tratsch, sondern den Kanon. Eine viel zitierte antike Idee: Zu jedem Landtier gebe es ein marines Gegenstück – perfekte Blaupause für See-Elefanten, Meerschweine und andere Hybride.
Theologie machte diese Vielfalt kosmologisch anschlussfähig. Augustinus interpretierte Monstrositäten nicht als Pannen der Schöpfung, sondern als Staunen provozierende admirabilia Dei. Enzyklopädisten wie Isidor von Sevilla sortierten dieses Wissen, ihre Etymologiae wurden zu Bildprogrammen ganzer Karten. Deshalb wirken viele Mappae Mundi eher wie Illustrierte der Heilsgeschichte: Ostung, Paradies am oberen Rand, Jerusalem im Zentrum – und überall erklärende Texte.
Der dritte Motor war ganz simpel: Unwissen. Terrae incognitae waren riesig; weiße Flecken erzeugen Furcht und Fantasie. Also rückten die Wunderwesen stets dorthin, wo die Evidenz endete: erst nach Indien und Libyen, dann in Skandinavien, Richtung Südkontinent – und nach 1492 in die Amerikas. Karten wurden so Seismografen des Wissensstands: Wo das Messbare aufhörte, begannen die Monster – als psychologische Grenzmarken zwischen der geordneten „eigenen“ und der chaotischen „anderen“ Welt.
Anatomie des Schreckens: Völker, Seeungeheuer, Fabeltiere
Die Bilderwelt folgt keiner Laune, sondern einer klaren Ikonographie, gespeist aus Antike und Bestiarien.
Wundervölker: Sie leben an Land, meist in Asien oder Afrika, und verschieben die Kategorie „Mensch“. Häufige Motive sind Blemmyer, Kynokephale, Skiapoden oder Panoti mit mantelgroßen Ohren. Ihre Deutung schwankt zwischen Ethnographie und Moralallegorie: barbarisch, verflucht, aber dennoch Teil der Schöpfung.
Seeungeheuer: Die Ozeane waren lebensgefährlich – und sahen auf Karten entsprechend aus. Einige Wesen sind Überzeichnungen realer Tiere: Wale, für Inseln gehalten, die ganze Schiffe in die Tiefe reißen; Walrosse mit dämonischer Physiognomie; Kraken und Rochen von übermenschlicher Größe. Daneben floriert die Welt hybrider Komposita – Fischkörper mit Eberkopf, Hundsmaul mit Flossen, Bärenpranken mit Schuppenschwanz –, fast immer in Angriffspose, Spiegelfläche maritimer Angst.
Fabelwesen: Drachen, Basilisken, Greifen, Einhörner – bekannte Figuren aus Bestiarien, regional verortet. In Indien bewachen Drachen Goldberge; der Basilisk erscheint als gekrönter Schlangenhahn; das Einhorn wird christologisch gedeutet. Wichtig ist: Diese Bilder belegen weniger Zoologie als Bedeutung – Reichweite, Gefahr, Reinheit, Macht.
Wenn dich diese Galerie der „mittelalterlichen Kartenmonster“ fasziniert, lass gern ein Like da und erzähl in den Kommentaren: Welches Wesen würdest du auf deiner eigenen Weltkarte platzieren – und warum?
Warum Monster auf die Karte mussten: Ästhetik, Markt, Mahnung
Leere ist anstrengend – und im 16. Jahrhundert fast schon verpönt. Der berühmte horror vacui („Scheu vor der Leere“) erklärt, warum Ozeane und Hinterländer mit Kompassrosen, Wappen, Schiffen und Ungeheuern gefüllt sind. Das kaschiert Wissenslücken und befriedigt ein damaliges Schönheitsideal: Dichte, Detail, Fülle. Karten waren Prestigeobjekte; Handarbeit auf Pergament wurde nach Aufwand bezahlt. Wer Monster bestellte, bezahlte auch für Prestige – und Druckverleger der Frühen Neuzeit lernten schnell, dass dramatische Seeattacken die Verkaufszahlen heben.
„Monster“ leitet sich von monere ab – mahnen, warnen. Genau das taten sie: ganz praktisch als nautische Marker (Stromschnellen, Strudel, „unkartierte Gefahrenzonen“) und moralisch-theologisch als Lehrbilder über Laster, Hochmut, Hybris. Der Mahlstrom in nordischen Gewässern, auf der Carta Marina eindrucksvoll inszeniert, steht zugleich für reale Strömungen und für die Unberechenbarkeit des Meeres. Der Kartenrand wurde so zum Rand der Vernunft – mit Rufzeichen.
Politik auf Pergament: Die Carta Marina als konfessionelles Manifest
Karten sind Argumente. Kaum irgendwo ist das so deutlich wie auf Olaus Magnus’ Carta Marina (1539). Der exilierte schwedische Katholik zeichnete nicht nur die skandinavischen Küsten präziser als viele Ptolemäus-Karten seiner Zeit; er schrieb eine politische Botschaft aufs Meer. Wappen und Bibelzitate adeln katholische Territorien, polemische Spitzen markieren protestantische Nachbarn. In den Gewässern tummeln sich Ungeheuer – und deren Platzierung ist alles andere als zufällig.
Aus heutiger Sicht plausibel sind drei Lesarten: Erstens die konfessionelle: Seeungeheuer attackieren Schiffe, die als dänisch oder „ketzerisch“ erkennbar sind – göttliche Warnzeichen im Bild. Zweitens die ökonomische: Furchterregende Wesen blockieren symbolisch fischreiche Fanggründe und schrecken Rivalen ab – ein visuelles Fangverbot. Drittens die militärische: Festungen, Schlachten auf dem Eis, „Bollwerke“ gegen Moskowiter – plus Unheilsgetier vor deren Küsten – zeichnen Grenzen nicht nur nach, sondern vor. Anders gesagt: Wer die Monster kontrolliert, beansprucht das Meer.
Visuelle Enzyklopädien: Hereford und Ebstorf als Lehrkarten
Lange vor der Navigationskarte dominierten Mappae Mundi – nicht als Wegweiser, sondern als Weltdeutung. Die Hereford-Karte (um 1300) bündelt Städte, Mythen, biblische Szenen und irdische Kuriosa auf einer einzigen Kalbshaut. Jerusalem im Zentrum, das Jüngste Gericht im Osten, dazu 30+ Fabeltiere und rund ebenso viele „seltsame Völker“: Skiapoden in Indien, Blemmyer in Afrika, das Einhorn als Symbol für Christus. Man könnte sagen: ein bebilderter Unterrichtsraum für Pilger.
Die Ebstorfer Weltkarte radikalisiert den Ansatz: Der orbis terrarum ist der Leib Christi – Kopf oben (Osten), Hände an den Seiten, Füße im Westen. Phönix, Basilisk, Kynokephale und Anthropophagen stehen nicht für Reiserouten, sondern für Bedeutungen. Begleittexte zitieren Isidor und andere Autoritäten, legen Eigenschaften und Typenverhalten fest. Das Entscheidende: Die Monster belegen keine Koordinaten, sondern eine Kosmologie.
Als die Drachen verschwanden: Empirie, Portolane, Projektion
Zwischen 15. und 17. Jahrhundert verschiebt sich das Koordinatensystem des Wissens. Entdeckungsfahrten bringen Daten statt Anekdoten: Küsten werden vermessen, Inseln überprüft, „weiße Flecken“ schrumpfen. Mit Kompass, Jakobsstab und bald auch mit astronomischen Methoden lässt sich Position bestimmen; Mercators winkeltreue Projektion (1569) macht Weltkarten endlich zu Werkzeugen der Navigation. Parallel setzen sich Portolankarten durch: Küsten, Häfen, Landmarken, Rumbenlinien – fertig. Für Angstgestalten bleibt schlicht kein Platz mehr.
Im späten 17. Jahrhundert professionalisieren Staaten die Kartenherstellung. Hydrographische Dienste publizieren standardisierte Seekarten – präzise, vergleichbar, wiederholbar. Der Ozean ist jetzt Bühne der Kontrolle: Schiffe statt Schreckgespenster. Das Verschwinden der Monster markiert nicht nur einen Stilwandel, sondern eine epistemische Revolution: von der Autorität der Überlieferung zur Autorität der Messung.
Nachhall: Unsere unsichtbaren Monster
Sind damit alle Drachen tot? Natürlich nicht. Heute heißen sie anders: verzerrende Projektionen, strategische Auslassungen auf Militärkarten, Datendünnheiten in digitalen Kartendiensten, algorithmische Bias. Auch moderne Karten sind nicht die Welt, sondern Entscheidungen über die Welt. Gerade deshalb lohnt der Blick zurück: Mittelalterliche „mittelalterliche Kartenmonster“ halten uns einen Spiegel vor. Sie erinnern daran, dass jede Karte eine Erzählung ist – und dass wir die Erzähler:innen mitdenken müssen.
Wenn dir dieser Beitrag gefallen hat, freue ich mich über ein Like. Welche Karte hat dein Bild der Welt geprägt? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!
Für mehr solcher Recherchen und Debatten folg unserer Community:
Quellen:
The Dragon Chronicles – The Hereford Mappa Mundi (PBS) - https://www.pbs.org/wnet/nature/the-dragon-chronicles-the-hereford-mappa-mundi/4524/
Wundervölker – Wikipedia - https://de.wikipedia.org/wiki/Wunderv%C3%B6lker
Eine Einführung: Monster (bpb) - https://www.bpb.de/shop/zeitschriften/apuz/175278/monster-eine-einfuehrung/
Medieval Maps and Monsters – History for Atheists - https://historyforatheists.com/2019/01/medieval-maps-and-monsters/
Fantasiewesen aus dem Mittelalter – Deutschlandfunk Kultur - https://www.deutschlandfunkkultur.de/fantasiewesen-aus-dem-mittelalter-als-monster-die-meere-100.html
Seeungeheuer und Fischkentauren – Welt der Wunder - https://www.weltderwunder.de/seeungeheuer-und-fischkentauren-mittelalterliche-monster-der-meere/
Monster im Mittelalter – Vandenhoeck & Ruprecht (Leseprobe) - https://www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com/downloads/productPreviewFiles/LP_978-3-412-51403-7.pdf
Ebstorfer Weltkarte – Blog „Fantastic Beasts“ (Uni Hamburg) - https://fantastic-beasts.blogs.uni-hamburg.de/tag/ebstorfer-weltkarte/
Mappa Mundi Exploration – Hereford - http://www.themappamundi.co.uk/mappa-mundi/
Mappa Mundi – Wikipedia - https://de.wikipedia.org/wiki/Mappa_mundi
Hereford Mappa Mundi – Wikipedia - https://en.wikipedia.org/wiki/Hereford_Mappa_Mundi
Carta Marina – Wikipedia - https://de.wikipedia.org/wiki/Carta_Marina
Carta Marina – Uppsala University - https://www.uu.se/en/library/visit-and-contact/exhibitions/carta-marina
About the Exhibit: Olaus Magnus’ Map of Scandinavia – UMN Gallery - https://gallery.lib.umn.edu/exhibits/show/olausmagnus
The Carta Marina of Olaus Magnus – Orkney Museums - https://www.orkneymuseums.co.uk/the-carta-marina-of-olaus-magnus-1539/
Unknown Europe: Mapping the Northern Countries – Belgeo - https://journals.openedition.org/belgeo/7677?lang=en
Ocean Eddies in the 1539 Carta Marina – The Oceanography Society - https://tos.org/oceanography/assets/docs/16-4_rossby.pdf
Horror vacui in Cartography – Geography Realm - https://www.geographyrealm.com/what-is-horror-vacui-in-cartography/
Horror vacui (Kunst) – Wikipedia - https://de.wikipedia.org/wiki/Horror_vacui_(Kunst)
BLRCC Spotlight Exhibit: Horror vacui (Stanford) - https://exhibits.stanford.edu/blrcc/feature/horror-vacui
Kartografie – Wikipedia - https://de.wikipedia.org/wiki/Kartografie
Zeitalter der Entdeckungen – Wikipedia - https://de.wikipedia.org/wiki/Zeitalter_der_Entdeckungen
Entwicklungsgeschichte der Seekarte – Wikipedia - https://de.wikipedia.org/wiki/Entwicklungsgeschichte_der_Seekarte
The Largest Medieval Map – Hereford Mappa Mundi - https://www.themappamundi.co.uk/




























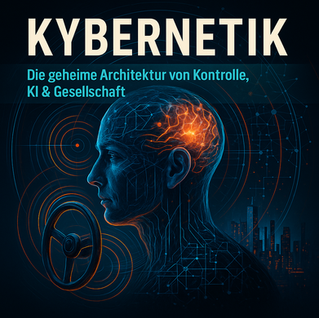

















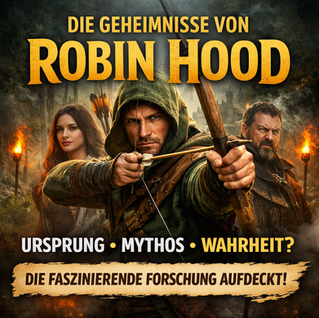





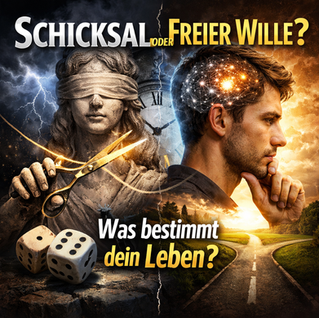









































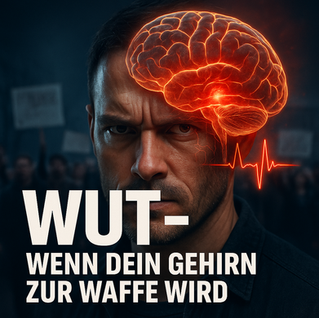












Kommentare