Der Schwarm, der Städte baut – Schwarmrobotik im Bauwesen
- Benjamin Metzig
- vor 2 Tagen
- 8 Min. Lesezeit

Stell dir eine Baustelle vor, auf der kein Bauleiter herumbrüllt, kein Kranfahrer in 40 Metern Höhe schwitzt und kein Maurer tonnenweise Steine schleppt. Stattdessen wuseln hunderte kleine Roboter wie ein Ameisen- oder Termitenschwarm über das Gelände, klettern über unfertige Wände, bringen Material in Position und lassen Schritt für Schritt ein Gebäude entstehen.Keine Science-Fiction-Concept-Art, sondern ein ernst gemeintes Forschungsprogramm aus Robotik, Architektur und KI.
Genau hier setzt die Vision der Schwarmrobotik im Bauwesen an: Weg von der zentral gesteuerten Großmaschine, hin zu vielen einfachen, vernetzten Agenten, die gemeinsam etwas Komplexes errichten.
Wenn dich solche Zukunftsszenarien reizen und du tiefer in die Schnittstellen von Wissenschaft, Technik und Gesellschaft eintauchen willst, hol dir direkt zu Beginn den monatlichen Wissenschaftswelle-Newsletter – damit du keine neue Story aus dieser entstehenden Roboterwelt verpasst.
Von der Blaupause zum Algorithmus: Warum Baustellen ein Paradigmenwechsel erwartet
Heute funktioniert Bauen im Kern noch wie vor Jahrzehnten: Ein Büro plant, erstellt detaillierte Pläne, Normen und Ablaufdiagramme. Auf der Baustelle setzen Menschen und einige wenige große Maschinen diese Pläne Schritt für Schritt um. Die Entscheidungslogik ist top-down: Einer sagt an, alle anderen führen aus.
Die Schwarmidee dreht dieses Prinzip um. Statt eines zentralen „Gehirns“ gibt es viele kleine, autonome Einheiten, die nur lokale Informationen nutzen: Wo liege ich? Welche Bauteile sind um mich herum? Ist hier ein Stein frei? Aus diesem lokalen Wissen entsteht – idealerweise – ein global geordnetes Ergebnis: ein fertig gebautes Gebäude.
Das ist mehr als „ein paar Roboter auf die Baustelle stellen“. Es bedeutet:
Automation: Roboter machen klar definierte, wiederholbare Aufgaben (z.B. Schweißen eines Punkts).
Autonomie: Roboter können selbst auf unerwartete Situationen reagieren.
Schwarmintelligenz: Viele autonome Roboter mit einfachen Regeln erzeugen gemeinsam komplexe Strukturen, ohne zentralen Masterplan.
Die Vision vieler Industrieprognosen nennt das „Level-5-Autonomie“: Die Baustelle, die sich selbst organisiert, geplant und ausgeführt durch KI, mit Menschen nur noch als überwachende Instanz.
Philosophisch ist das ein Schlag ins Gesicht des klassischen Architektenideals. Denn wenn Gebäude aus den Interaktionen eines Schwarms entstehen, wer ist dann noch der „Autor“ der Form? Die Antwort vieler Forschender: Der Beruf wandelt sich – weg vom Zeichnen einer endgültigen Form, hin zum Entwerfen von Verhaltensregeln. Der Architekt oder die Ingenieurin der Zukunft schreibt Algorithmen statt nur Grundrisse.
Termiten, Ziegel und Stigmergie: Was das TERMES-Modell wirklich kann
Die Blaupause für diesen Paradigmenwechsel kommt – wenig glamourös – aus dem Termitenhügel. Termiten sind klein, oft blind und haben keinerlei Überblick über das große Ganze. Trotzdem bauen sie Konstruktionen, die in Relation zu ihrer Körpergröße an Kathedralen erinnern: mit Belüftungsschächten, Kammern, Schutzstrukturen.
Der Trick heißt Stigmergie: Statt sich direkt abzusprechen, hinterlassen Termiten Spuren in der Umwelt – etwa Lehmhäufchen oder chemische Signale –, an denen andere Termiten ihr Verhalten ausrichten. Die Umgebung selbst wird zur Kommunikationsfläche.
Das Wyss Institute der Harvard University hat genau dieses Prinzip im TERMES-Projekt in Robotik übersetzt. Die TERMES-Roboter sind bewusst simpel gehalten: Sie können sich bewegen, drehen, Ziegel hoch- und herunterklettern, Steine aufnehmen und ablegen. Mit wenigen Regeln:
Folge einfachen „Verkehrsregeln“ (Kollisionen vermeiden).
Suche einen Startstein als Orientierungspunkt.
Klettere auf die Struktur.
Nimm einen Ziegel auf.
Lege ihn an einer lokal gültigen Position ab.
Klettere herunter.
Wiederhole das Ganze.
Das wirkt fast kindlich einfach – und gerade das ist die Pointe. Selbst wenn einzelne Roboter ausfallen, macht der Rest einfach weiter. Die Robustheit entsteht aus der Masse.
Aber: So romantisch das Bild vom „blinden Schwarm, der intuitiv Architektur schafft“ ist – technisch stimmt es so nicht. Im Hintergrund existiert ein vordefinierter structpath, eine Art abstrakter Bauplan, der im Vorfeld berechnet wird. Der berühmte „Start-Ziegel“ dient als Nullpunkt dieses Koordinatensystems. Die Roboter entscheiden also nicht was gebaut wird, sondern nur wie sie sich dezentral koordinieren, um dieses „Was“ umzusetzen.
Kurz: TERMES löst vor allem das Koordinationsproblem auf der Baustelle, nicht das Designproblem. Für reale Gebäude ist das auch nötig – niemand will einen emergenten Balkon, der „ungeplant“ einen Meter zu kurz geraten ist.
Der unsichtbare Schwarm: Digitale Agenten als Entwurfswerkzeug
Während Harvard hauptsächlich an physischen Robotern schraubt, arbeitet das Institut für Computational Design (ICD) in Stuttgart an der anderen Hälfte der Gleichung: dem digitalen Schwarm.
Statt reale Roboter über Baustellen laufen zu lassen, simuliert das ICD Tausende digitale Agenten in einer virtuellen Umgebung aus Voxeln – winzigen, dreidimensionalen „Pixeln“ im Raum. Der Architekt entwirft hier keine konkrete Form, sondern ein Set von Verhaltensregeln:
Wie reagieren Agenten auf Materialgrenzen?
Welche Bereiche müssen besonders stabil sein?
Wie spielen Tageslicht, Klima oder Nutzungsanforderungen hinein?
Diese Agenten „lernen“ in der Simulation, probieren aus, ordnen sich neu und generieren räumliche Lösungen, die oft jenseits menschlicher Intuition liegen. Schwarmlogik wird damit zum generativen Designwerkzeug, nicht bloß zur Spielerei.
Die Verbindung zur physischen Welt ist absehbar:Das, was heute als Simulation läuft, kann morgen zum Regelwerk für reale Bauschwärme werden. Das ICD liefert das Design der Regeln, Harvard zeigt, wie ein physischer Schwarm diese Regeln autonom ausführt. Dazwischen liegt eine Übersetzungsschicht – eine algorithmische Pipeline vom digitalen Entwurf zur physischen Konstruktion.
Was heute schon geht: Roboter auf echten Baustellen
Die Vision ist klar – aber wie sieht die Realität 2025 auf Baustellen aus? Ehrliche Antwort: Von einem echten Schwarm sind wir noch weit entfernt. Was wir sehen, sind hochautomatisierte Inseln.
An der ETH Zürich etwa zeigt das Projekt MESH, wie ein großer Roboterarm Bewehrungsstahl autonom greifen, biegen, platzieren und schweißen kann. Die Formen, die dabei entstehen, wären manuell kaum machbar – zu komplex, zu mühsam. Aber die Steuerlogik bleibt zentralisiert: Eine Software berechnet exakt, was der Roboter tun soll, der Arm folgt diesem Pfad millimetergenau. Schwarmintelligenz? Fehlanzeige.
Ein zweiter Ansatz kommt vom Rensselaer Polytechnic Institute (RPI) in den USA. Dort arbeitet ein Team von Robotern mit Menschen zusammen, um Notunterkünfte schneller aufzubauen. Die Roboter halten, drehen oder straffen schwere Bauteile – der Mensch trifft die Entscheidungen, der Roboter ist Assistent.
Beide Beispiele zeigen: Heute dominieren Automation und Mensch-Roboter-Kollaboration, nicht autonome Schwärme. Aber sie liefern Bausteine:
MESH entwickelt die „Hände“ für das Biegen und Schweißen von Stahl.
RPI testet robuste, mobile Plattformen und Workflows für das Hantieren mit schwerem Material.
Der spätere Schwarm wird aus vielen solcher spezialisierten Agenten bestehen – bloß orchestriert er sich dann selbst.
Wie der digitale Zwilling zum Nervensystem der Baustelle wird
Spätestens beim Blick in Richtung 2030 fällt ein Begriff immer wieder: Digitaler Zwilling. Gemeint ist ein extrem detailreiches, dynamisches 3D-Modell der Baustelle und des späteren Gebäudes, das in Echtzeit mit Daten gefüttert wird – von Sensoren, Drohnen, Robotern.
Hier trifft sich die Biomimetik mit Hightech. Stigmergie beschreibt, wie Termiten über die Umwelt indirekt miteinander kommunizieren. Auf einer physischen Baustelle ist diese „Umwelt“ allerdings chaotisch: Staub, Lärm, Funklöcher, komplexe Geometrien. Ein digitaler Zwilling kann diese Rolle viel robuster übernehmen.
Ein Beispiel:Ein Inspektionsdrone erkennt eine fehlerhafte Schweißnaht an Position 47.1. Sie muss nicht direkt mit einem Schweißroboter „sprechen“. Stattdessen schreibt sie eine Statusänderung in den Digitalen Zwilling: „Naht 47.1 defekt“. Ein anderer Roboter, spezialisiert auf Reparaturen, liest diese Information aus der gemeinsamen digitalen Umgebung und plant seinen Einsatz.
Der digitale Zwilling wird damit zum gemeinsamen Gedächtnis und Kommunikationsraum des Schwarms – eine hochauflösende, ständig aktualisierte Version der Baustellenrealität. Und darüber legt sich eine weitere Schicht: generative KI, die aus diesem Datenstrom neue Abläufe, Optimierungen und Reparaturstrategien ableitet.
Bremsklötze der Revolution: Technik, Recht, Verantwortung
Klingt alles ziemlich elegant. Aber sobald wir aus der Laborwelt in reale Städte wechseln, knallen die Hürden aufeinander.
Technische Probleme:
Koordination: Viele autonome Agenten ohne Chaos miteinander arbeiten zu lassen, ist extrem anspruchsvoll – insbesondere bei wechselndem Wetter, Materialtoleranzen und unvorhersehbaren Ereignissen.
Kommunikation: Funk in Stahlbeton, Staub, Wasser, Lärm – robuste Netze auf Baustellen sind ein Albtraum.
Energie: Kleine, mobile Roboter brauchen Strom. Ständig zur Ladestation fahren zu müssen, killt Autonomie.
Sicherheit: Ein gehackter Bauschwarm, der unbemerkt falsche Strukturen baut, wäre ein Alptraum-Szenario.
Noch härter wird es bei Recht und Ethik. Unser Haftungsrecht ist auf klar zuweisbare Verantwortung ausgelegt: Wenn etwas schiefgeht, gibt es einen Verursacher. Bei einem emergenten Schwarm verschwimmt diese Logik. Wer haftet, wenn eine Vielzahl von Robotern kollektiv eine fehlerhafte Struktur errichtet?
Der Architekt, der die Regeln geschrieben hat?
Die KI, die diese Regeln optimiert hat?
Der Hersteller der Roboter?
Der Betreiber der Baustelle?
Solange diese Fragen ungeklärt sind, wird kein seriöser Bauherr eine Brücke oder ein Hochhaus komplett von einem autonomen Schwarm errichten lassen – egal, wie beeindruckend die Laborprototypen sind.
Gleichzeitig explodiert der Markt für Schwarmrobotik, vor allem getrieben von Verteidigung, Luft- und Raumfahrt sowie gefährlichen Einsatzumgebungen. Das zeigt: Die riskanten Anwendungsfelder finanzieren die Entwicklung, der zivile Bau profitiert – aber er wird nicht die Speerspitze sein.
Roadmap in die Zukunft: Was bis 2030 realistisch ist – und was nicht
Was bedeutet das alles konkret für den Horizont 2030? Wenn wir die aktuellen Projekte ehrlich betrachten, zeichnet sich eher eine Evolution als eine plötzliche Revolution ab.
Kurzfristig (1–5 Jahre) dominieren spezialisierte Automationsinseln und Mensch-Roboter-Teams. Schwarmrobotik kommt hauptsächlich bei Inspektion, Vermessung, Logistik und vielleicht bei modularen Fassadensystemen zum Einsatz.
Mittelfristig (5–15 Jahre) sehen wir hybride Baustellen: Menschen arbeiten mit größeren „Makro-Bots“ zusammen, dazu kommen kleinere Schwärme für wiederholbare Aufgaben – etwa das Setzen von standardisierten Bauteilen. Digitale Zwillinge werden zum Standard, um all diese Akteure zu koordinieren.
Langfristig (15+ Jahre) wird die Vision der vollautonomen, heterogenen Schwärme realistischer – aber nur, wenn die Rechtslage mitzieht und sich KI-Systeme transparent und auditierbar gestalten lassen. Dann könnten sich Bauschwärme selbst organisieren, Fehler frühzeitig erkennen, Reparaturen autonom auslösen und Infrastrukturen im laufenden Betrieb „selbstheilend“ halten.
Wird 2030 schon ein kompletter Wolkenkratzer von einem Schwarm autonom gebaut? Eher nicht. Aber eine Reihe standardisierter Strukturen – von Solarfeldern über einfache Hallen bis hin zu Notunterkünften – könnte dann durchaus ohne menschliche Handarbeit entstehen.
Und wir? Architektur, Arbeit und Gesellschaft im Spiegel der Schwärme
Beim Blick auf Schwarmrobotik im Bauwesen geht es nicht nur um Maschinen, sondern um uns. Was passiert mit Berufen, Identitäten, Machtstrukturen?
Architektinnen und Ingenieure könnten vom Formzeichner zum Regel-Designer werden – eine Rolle, die eher an Spielentwickler oder KI-Trainer erinnert. Bauarbeiter verlieren sicher einen Teil ihrer klassischen Tätigkeiten, gewinnen aber potenziell neue Aufgaben: Überwachung, Wartung, Supervision komplexer Systeme, Arbeitssicherheit, Qualitätssicherung.
Und gesellschaftlich? Städte, die von Schwärmen gebaut und instand gehalten werden, könnten flexibler, reparierbarer, weniger von Großprojekten abhängig sein. Gleichzeitig wächst die Abhängigkeit von komplexer Software, großen Tech-Anbietern und militärisch geprägter Robotikforschung.
Die entscheidende Frage lautet daher: Wer bestimmt die Regeln, nach denen die Schwärme handeln? Wenn wir diese Entscheidung nur der Industrie oder dem Militär überlassen, dürfen wir uns nicht wundern, wenn am Ende Effizienz über Gemeinwohl steht.
Wenn dich diese Fragen genauso umtreiben wie mich, dann lass dem Beitrag ein Like da und schreib in die Kommentare, welche Chancen und Risiken du siehst. Und wenn du tiefer in solche Themen einsteigen willst, schau bei der Wissenschaftswelle-Community vorbei – hier geht es weiter:
Quellen:
Collective Construction with Robot Swarms – Harvard SEAS (TERMES-Grundlagen) - https://people.seas.harvard.edu/~jkwerfel/morpheng.pdf
Swarm Robots – Wie aus einfachen Regeln emergente Systeme entstehen - https://opus4.kobv.de/opus4-fhpotsdam/files/126/swarm_robots_meyleankronemann_print.pdf
Autonomous Construction 2025 – How AI, Robotics & Drones Build ... - https://logiciel.io/blog/autonomous-construction-ai-robotics-drones-ecosystems-2025
Can Swarm Robotics Help Construction? | Built - The Bluebeam Blog - https://blog.bluebeam.com/swarm-robotics/
Termite-inspired robots – Überblick TERMES - https://en.wikipedia.org/wiki/Termite-inspired_robots
TERMES: A Robotic Swarm That Collectively Constructs Modular Structures | ArchDaily - https://www.archdaily.com/480158/harvard-team-develop-robotic-collective-construction-techniques
Robotic construction crew needs no foreman - Harvard SEAS - https://seas.harvard.edu/news/2014/02/robotic-construction-crew-needs-no-foreman
Watch: Harvard scientists develop tiny robots that can swarm | PBS News - https://www.pbs.org/newshour/science/watch-harvard-scientists-develop-tiny-robots-can-swarm
TERMES: An Autonomous Robotic System for Three-Dimensional Collective Construction - https://www.roboticsproceedings.org/rss07/p35.pdf
Institute for Computational Design and Construction | University of Stuttgart - https://www.icd.uni-stuttgart.de/
Computational Discourses, Commentary 01: ICD, University of Stuttgart | Interviews - https://au-magazine.com/interviews/computational-discourses-01-icd/
Swarming | Institute for Computational Design and Construction ... - https://www.icd.uni-stuttgart.de/teaching/seminars/swarming/
Institute for Computational Design (ICD) University of Stuttgart - Architizer - https://architizer.com/firms/institute-for-computational-design-icd-university-of-stuttgart/
DFAB HOUSE – Building with robots and 3D printers - https://dfabhouse.ch/
Robots assemble reinforcing steel | ETH Zurich (MESH) - https://ethz.ch/en/news-and-events/eth-news/news/2025/06/eth-spin-off-mesh-automates-reinforcement-work.html
ETH Zurich University collaborates with ABB robots - https://www.youtube.com/watch?v=zStAstDC-AE
Project Highlight: Swarm Robotics for Large Structure Manufacturing - ARM Institute - https://arminstitute.org/news/project-highlight-swarm-covid/
TERMES - Videoeinblick in den Bauschwarm - https://www.youtube.com/watch?v=nFjtRONfae4
Swarm robotics could spell the end of the assembly line - The Robot Report - https://www.therobotreport.com/swarm-robotics-could-spell-end-aerospace-assembly-line/
News: The Future of Swarm Robotics: Applications and Challenges - https://www.automate.org/news/the-future-of-swarm-robotics-applications-and-challenges-123

























































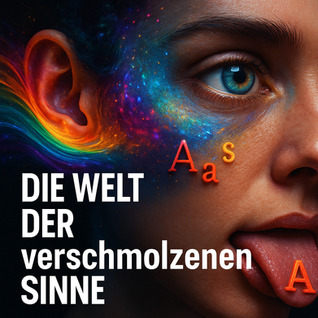














































Kommentare