Die Legitimität der Stadtbild-Debatte
- Benjamin Metzig
- 23. Okt.
- 7 Min. Lesezeit

Wenn dich solche tiefen, aber leicht lesbaren Analysen faszinieren: Abonniere gern meinen monatlichen Newsletter für fundierte Wissenschafts- und Gesellschaftsartikel – ganz ohne Spam, versprochen.
Wessen Stadtbild? Zwischen Angst, Identität und Wirklichkeit
„Stadtbild“ klingt nach Postkartenromantik: Giebel, Laternen, Kopfsteinpflaster. Doch in Deutschlands aktueller Auseinandersetzung ist der Begriff zur Projektionsfläche geworden – für Sorgen um Sicherheit, für Identitätsfragen und für parteipolitische Strategien. Die Debatte entzündete sich an vagen Formulierungen des Bundeskanzlers Friedrich Merz, die Migration, Kriminalität und ein angeblich „verfallenes“ Erscheinungsbild der Städte in einem Atemzug nennen. Das Problem: Was genau gemeint ist, bleibt bewusst unscharf. Genau diese Unschärfe ist wirksam, weil sie individuelle Ängste triggert und komplexe Ursachen ausblendet.
Die Legitimität der Stadtbild-Debatte hängt damit an einer Kernfrage: Reden wir über die Menschen im öffentlichen Raum – also über Armut, Obdachlosigkeit, Drogenkonsum, marginalisierte Gruppen – oder über Fassaden, Plätze und architektonische Hüllen? Beides wird rhetorisch verknüpft, als ließe sich ein „unschönes“ soziales Phänomen mit Abschiebungen, Platzverweisen oder Fassadenputz beheben. Doch so funktioniert Stadt nicht. Stadt ist immer beides: sozialer Lebensraum und gebaute Bühne – und wer nur an der Kulisse zupft, verändert nicht die Handlung.
Was „Stadtbild“ wirklich meint
Auf der sozialen Ebene geht es um Sichtbarkeit: Wer prägt Plätze, Bahnhöfe, Parks? Wen empfinden wir als „störend“? Wer gilt als „zugehörig“? Wenn Migration, Obdachlosigkeit oder Sucht sichtbar werden, wird daraus schnell ein moralischer Makel gemacht. Aus Symptomen sozialer Ungleichheit wird dann ein Kulturkampf.
Parallel dazu existiert die architektonische Ebene: Fragen der Baukultur, des Wiederaufbaus, des Rekonstruierens historischer Schätze versus moderner Gestaltung. Diese Debatte hat Tiefe und Tradition, sie verhandelt Identität durch Steine, Plätze und Silhouetten. Brisant wird es, wenn beide Ebenen absichtlich verschmiert werden: Menschen werden zu „Störfaktoren“ im ästhetischen Bild erklärt – als wären Armut oder Krankheit Graffiti, die man überstreichen kann. Genau hier kippt die Diskussion ins Illegitime: wenn soziale Komplexität ästhetisch etikettiert und politisch aus dem Blickfeld entfernt werden soll.
Wie politische Unschärfe wirkt: Rhetorik, Narrative, Verschiebungen
Die jüngste Zuspitzung startete mit einer vagen Problembehauptung des Bundeskanzlers: Es „gebe da etwas im Stadtbild“. Konkrete Phänomene – Wohnungsnot, Drogenkrisen, Prekarität – wurden nicht benannt, eine klare „Lösung“ aber sehr wohl: mehr Abschiebungen. Dieses Koppeln von Unklarheit (Problem) und Klarheit (Sanktion) ist politisches Kalkül. Es aktiviert Ressentiments, ohne sie auszusprechen, und lässt den Sprecher im Zweifel sagen: „Ich habe nichts Konkretes behauptet.“
Später folgte die geschlechtliche Sicherheitsfigur: „Fragen Sie Ihre Tochter.“ Damit wird das reale Thema Gewalt gegen Frauen instrumentalisiert, um Migrationspolitik zu begründen – statt patriarchale Strukturen, Prävention, Opferschutz, Täterarbeit und Justizressourcen zu stärken. Wer Sicherheit ernst meint, muss genau dort handeln, wo Gewalt entsteht – unabhängig von Herkunft.
Zudem beobachten wir eine Normalisierung radikaler Narrative: Begriffe und Bilder, die lange am rechten Rand zirkulierten – „sauberes Stadtbild“, „Heimat pflegen“ – rücken in die Mitte. Das verschiebt den Referenzrahmen („Overton Window“): Was gestern noch als extrem galt, erscheint heute sagbar. Ironie der Strategie: Wer radikale Frames übernimmt, gewinnt vielleicht kurzfristig Schlagzeilen – langfristig stärkt er genau die Weltsicht, die er eigentlich begrenzen will.
Geschichte in Backstein: Warum „schöne“ Städte politisch sind
Die Sehnsucht nach einem „harmonischen“ Stadtbild ist älter als die aktuelle Debatte. Nach 1945 stand Deutschland vor einer doppelten Aufgabe: Wiederaufbau der Städte und Neudefinition der Identität. In Westdeutschland dominierten Moderne, Funktionalismus und die autogerechte Stadt – breite Straßen, neue Raster, ökonomische Effizienz. In der DDR prägten politisch aufgeladene Achsen, Repräsentationsbauten und später industrieller Wohnungsbau das Bild. Beide Pfade zeigen: Stadtplanung war nie neutral, sie war immer Ideologie in Beton.
Seither ringt die Bundesrepublik um Rekonstruktion vs. Modernität. Der Wiederaufbau der Frauenkirche, das Humboldt Forum im Berliner Schloss – für die einen Heilung und Kontinuität, für andere „Disney-Kulissen“ und das Tilgen unbequemer Geschichte. Architektur ist Identitätspolitik im Steinformat: Sie erzählt, wer „wir“ sind – und wer fehlt. Wer heute nostalgische Hüllen zur Norm erhebt, verhandelt oft unbewusst eine soziale Utopie der Homogenität. Doch die Gegenwart ist vielfältig – in Lebensstilen, Herkunft, Glauben, Einkommen. Eine ehrliche Baukultur muss diese Realität ausdrücken, nicht wegkurieren.
Sicherheit: Daten gegen Gefühle – und warum beides zählt
Kriminologie unterscheidet objektive Sicherheit (Daten, Delikte) und subjektive Sicherheit (Gefühl, Wahrnehmung). Diese Ebenen fallen häufig auseinander. Medienbilder, politische Frames und räumliche Eindrücke (Dunkelheit, Verwahrlosung, fehlende soziale Kontrolle) färben unser Empfinden stark. Seriöse Politik nimmt das Gefühl ernst – und prüft zugleich die Fakten.
Was sagen die? Empirische Analysen zeigen: Ein höherer Migrantenanteil in einem Viertel bedeutet nicht automatisch mehr lokale Kriminalität. Überrepräsentanzen in Statistiken ergeben sich wesentlich aus sozialen Lagen, nicht aus Herkunft. Menschen mit wenig Geld landen häufiger in ohnehin belasteten Quartieren, mit schlechter Infrastruktur und weniger Chancen. Wer hier pauschal Kultur statt Struktur adressiert, verwechselt Ursache und Symptom.
Beliebt in Debatten ist die Broken-Windows-Theorie: Unordnung signalisiere Schwäche, deshalb führe das Reparieren der „kleinen Dinge“ zu weniger Kriminalität. Klingt plausibel, ist aber als Kausalkette dünn belegt. Erfolg hatten vor allem kooperative, lösungsorientierte Ansätze – nicht repressive „Nulltoleranz“. Besonders spannend: In kontrollierten Studien zeigten sich Nachahmungseffekte kleiner Regelverstöße teilweise stärker in „ordentlichen“ Wohlstandsvierteln als in benachteiligten Quartieren. Das widerspricht dem Reflex, ausschließlich „Problemkieze“ hart zu reglementieren.
Ein differenzierterer Ansatz ist CPTED (Crime Prevention Through Environmental Design): Beleuchtung, Einsehbarkeit, klare Raumabgrenzungen und Pflege reduzieren Tatgelegenheiten und stärken subjektive Sicherheit. Aber auch hier gilt: zu viel Kontrolle erzeugt sterile, exklusive Räume – „defensive Architektur“, in der Bänke gegen Obdachlose schräg gestellt werden. Sicherheit darf nicht gegen Humanität ausgespielt werden. Gute Prävention baut auf Lebendigkeit, Präsenz und sozialer Verantwortung – nicht auf Verdrängung.
Die wirkliche Stadt: Super-Diversity, Segregation, Gentrifizierung
Die urbane Realität ist Vielfalt – nicht nur ethnisch, sondern auch sozial, religiös, kulturell. Das erzeugt Reibung, ja. Aber genau daraus erwachsen Innovation, Kreativität, Resilienz. Aufgabe von Stadtpolitik ist daher nicht, Vielfalt zu reduzieren, sondern sie gestaltbar zu machen: Begegnungsräume schaffen, Regeln des Respekts durchsetzen, Beteiligung organisieren, Zivilgesellschaft stärken.
Gleichzeitig spalten Segregation und Gentrifizierung die Stadt. Wer wenig verdient, wird in bestimmte Viertel gedrängt – nicht aus Wahl, sondern mangels Optionen. Dort kumulieren Probleme: mangelnde Kita- und Schulplätze, schwache Infrastruktur, Stigmatisierung. Auf der anderen Seite verwandeln Investitionen und touristische Aufwertung gewachsene Nachbarschaften. Steigende Mieten, verdrängte Läden, neue Codes – und das Gefühl, im eigenen Quartier fremd zu werden. Studien zeigen: Gentrifizierung kann die gefühlte Sicherheit der Alteingesessenen mindern, weil Kontrolle und Heimatgefühl schwinden. Das steht Kopf zur gängigen Behauptung, „Unordnung“ entstehe primär durch Arme oder Zugewanderte. Oft erzeugt erst der ökonomische Druck Unsicherheit – nicht die Präsenz der Armen, sondern ihre Verdrängung.
Kurz: Wer ernsthaft am „Stadtbild“ arbeiten will, muss über Wohnungspolitik, Sozialstaat, Suchthilfe, Gesundheitsversorgung, Bildung und Arbeitsmarkt reden. Abschiebungen lösen keine Drogenkrisen, keine Mietexplosion, keine Kinderarmut. Sie verschieben nur das Sichtbare – und verschärfen das Unsichtbare.
Legitimität der Stadtbild-Debatte: Ein Realitätscheck
Messen wir die Legitimität der Stadtbild-Debatte an vier Kriterien, zeigt sich ein klares Bild:
Faktenlage: Die simple Kausalbehauptung „mehr Migration = mehr Kriminalität“ hält empirisch nicht. Strukturfaktoren erklären Kriminalitätsbelastung deutlich besser.
Problemdiagnose: Aus sozialen Krisen werden kulturelle Gegensätze konstruiert. Das ist wissenschaftlich schwach und politisch bequem.
Angst-Politik: Subjektive Unsicherheit – gerade von Frauen – wird rhetorisch instrumentalisiert, statt mit Ressourcen und Maßnahmen (Aufklärung, Opferschutz, Täterprogramme, sichere Infrastruktur) adressiert zu werden.
Diskursverschiebung: Die Übernahme rechter Kampfbegriffe normalisiert exklusive Identitätspolitik und erodiert demokratische Brandmauern.
Fazit: In ihrer dominanten Form ist die Debatte weitgehend illegitim. Sie löst keine urbanen Probleme, sondern verschiebt sie – von der Sozial- auf die Kulturschiene – und bietet Sündenböcke statt Lösungen.
Was eine legitime Stadtdebatte leisten muss
Wie sähe eine Debatte aus, die Probleme wirklich angeht?
Erstens: Vom Kulturkampf zur Sozialpolitik. Investiere in bezahlbaren Wohnraum, Sucht- und Psychiatriehilfe, niedrigschwellige Angebote, Schulsozialarbeit, Integrations- und Arbeitsmarktprogramme. Miss Erfolge nicht an Schlagzeilen, sondern an stabileren Biografien.
Zweitens: Von Exklusion zu Inklusion. Plane öffentliche Räume, die Begegnung ermöglichen: sichtbare Präsenz von Verwaltung, Quartiersmanagement, Streetwork; Flexzonen statt Sperrzonen. Binde jene ein, die selten gehört werden – Obdachlose, Jugendliche, migrantische Communities, Alleinerziehende.
Drittens: Von Angstbildern zu Evidenz. Stärke CPTED mit Augenmaß, repariere „kleine Dinge“ ohne Schikane, fördere Nutzungsmischung und soziale Kontrolle durch Lebendigkeit. Entwickle integrierte Sicherheitskonzepte, die Polizei, Sozialarbeit, Stadtplanung und Zivilgesellschaft koordiniert.
Viertens: Von Nostalgie zur Zukunftsfähigkeit. Baukultur darf Erinnerung pflegen, aber sie muss die Gegenwart abbilden: klimaneutral, barrierearm, bezahlbar, vielfältig. Identität entsteht nicht nur aus Fassaden – sondern aus Zugehörigkeit.
Wenn dich dieser Ansatz überzeugt, lass gern ein Like da und sag mir in den Kommentaren, wie dein Viertel Sicherheit, Vielfalt und Teilhabe besser leben könnte. Mehr laufende Debatten, erklärende Reels und Visuals findest du in unserer Community:
Ein anderes Kriterium für ein gutes Stadtbild
Das wahre Qualitätskriterium eines Stadtbilds ist nicht die ethnische Zusammensetzung der Passanten, sondern die Würde, die eine Stadt ihren Bewohnerinnen und Bewohnern ermöglicht: ein sicheres Leben, bezahlbare Miete, verlässliche Hilfe in Krisen, Raum für Verschiedenheit, Chancen für Kinder. Eine Debatte, die diesen Maßstab verlässt, wird zum Risiko für den Zusammenhalt. Eine Debatte, die ihn ernst nimmt, macht Städte für alle besser – sichtbar und unsichtbar.
#Stadtbild #Sicherheit #Gesellschaft #Migration #Stadtentwicklung #Gentrifizierung #Baukultur #Sozialpolitik #Kriminologie #Diversität
Quellen:
„Stadtbild“-Debatte polarisiert: Leser zwischen Zustimmung und Kritik – https://www.focus.de/politik/meinung/stadtbild-debatte-polarisiert-leser-zwischen-zustimmung-und-kritik_d7c59c1e-0744-4549-8ff7-0946b657e177.html
Friedrich Merz und das Problem mit dem „Stadtbild“ – https://www.deutschlandfunk.de/friedrich-merz-stadtbild-migration-diskussion-100.html
Streit eskaliert: Sind schöne Gebäude rechts? – https://www.youtube.com/watch?v=WlTlI5telic
Optionen der Wirklichkeit: Neubau – Wiederaufbau – Rekonstruktion? – https://journals.ub.uni-heidelberg.de/index.php/kunsttexte/article/download/87927/82344
Politics, Architecture, and Identity in Rebuilding West Germany’s Cities after WWII – https://www.researchgate.net/publication/380845597_Politics_Architecture_and_Identity_in_Rebuilding_West_Germany's_Cities_after_the_Second_World_War
Stadtbild-Debatte: Thema komplett verfehlt, Herr Bundeskanzler – https://www.spiegel.de/politik/deutschland/stadtbild-debatte-thema-komplett-verfehlt-herr-bundeskanzler-kommentar-a-27fd777a-7011-4623-a3c0-9abdd0a5c748
Stadtbild-Debatte: Was Friedrich Merz in der migrantischen Community auslöst – https://www.spiegel.de/politik/stadtbild-debatte-was-friedrich-merz-in-der-migrantischen-community-ausloest-a-df9e4fd9-e7ac-487d-94ec-bd2676481430
«Fragen Sie Ihre Tochter» – Hat Deutschland wirklich „dieses Problem“? – https://www.srf.ch/news/international/fragen-sie-ihre-tochter-hat-deutschland-wirklich-dieses-problem-im-stadtbild
„Stadtbild“-Debatte – Polizeigewerkschafter unterstützt Merz – https://www.deutschlandfunk.de/polizeigewerkschafter-unterstuetzt-merz-aussage-rund-2-000-menschen-bei-protestkundgebung-wir-sind-d-102.html
„Stadtbild“-Debatte: CDU-Sozialflügel kritisiert Merz – https://www.trtdeutsch.com/article/e423cc898203
„Stadtbild“-Debatte: Marcel Fratzscher warnt vor wirtschaftlichen Folgen – https://www.zeit.de/politik/deutschland/2025-10/stadtbild-aussage-merz-kritik-fratzscher-gxe
Berlin 1945 – Fotos vom Kriegsende im Vergleich – https://www.tip-berlin.de/stadtleben/geschichte/berlin-1945-gegenwart-kriegsende-fotos-vorher-nachher-heute/
Infrastruktur und Gesellschaft im zerstörten Deutschland – bpb – https://www.bpb.de/themen/nationalsozialismus-zweiter-weltkrieg/dossier-nationalsozialismus/39602/infrastruktur-und-gesellschaft-im-zerstoerten-deutschland/
Kriegszerstörung und Wiederaufbau deutscher Städte nach 1945 – Nationalatlas – https://archiv.nationalatlas.de/wp-content/art_pdf/Band5_88-91_archiv.pdf
Vier Jahrzehnte Wiederaufbau in der Bundesrepublik Deutschland – bpb – https://www.bpb.de/shop/zeitschriften/apuz/archiv/534749/vier-jahrzehnte-wiederaufbau-in-der-bundesrepublik-deutschland/
Die 16 Grundsätze des Städtebaus – Wikipedia – https://de.wikipedia.org/wiki/Die_16_Grunds%C3%A4tze_des_St%C3%A4dtebaus
Städtebau – die sozialistische Stadt (DDR) – https://www.zeitklicks.de/ddr/kultur/architektur/staedtebau-die-sozialistische-stadt
Broken-Windows-Theorie – https://de.wikipedia.org/wiki/Broken-Windows-Theorie
Die brüchige Logik der Abwärtsspirale – LMU München – https://www.lmu.de/de/newsroom/newsuebersicht/news/die-bruechige-logik-der-abwaertsspirale.html
Städtebauliche Kriminalprävention – SozTheo – https://soztheo.de/stadtsoziologie/raum-und-un-sicherheit-staedtebauliche-kriminalpraevention/
Städtebauliche Kriminalprävention – Deutscher Städte- und Gemeindebund – https://www.dstgb.de/themen/sicherheit/kriminal-und-alkoholpraevention/staedtebauliche-kriminalpraevention/staedtebauliche-kriminalpraevention.pdf?cid=91i
Kulturelle Vielfalt in Städten – Bertelsmann Stiftung – https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/Projekte/Vielfalt_Leben/Studie_LW_Kulturelle_Vielfalt_in_Staedten_2018_01.pdf
Zwischen Erhalt, Aufwertung und Gentrifizierung – BBSR – https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/veroeffentlichungen/izr/2014/4/Inhalt/izr-4-2014-komplett-dl.pdf?__blob=publicationFile&v=1
Gentrifizierung in Großstädten: Verlust an gefühlter Sicherheit – https://www.psychologie-aktuell.com/news/aktuelle-news-psychologie/news-lesen/gentrifizierung-in-grossstaedten-verlust-an-gefuehlter-sicherheit-und-vertrautheit.html
Konzeption für eine sichere Innenstadt – Stadt Stuttgart – https://www.stuttgart.de/medien/ibs/broschuere-konzeption-sichere-innenstadt.pdf





















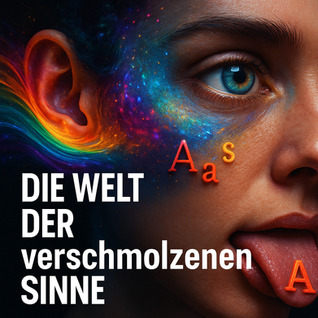



























































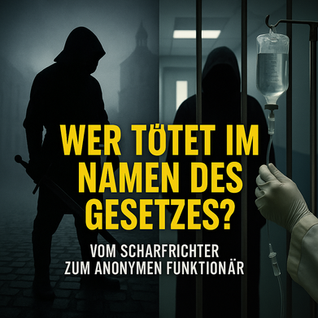






















Kommentare