Vom „Hund in der Pfanne“: Der Ursprung deutscher Redewendungen – skurrile Bilder, harte Belege und ein bisschen Streit
- Benjamin Metzig
- 7. Sept. 2025
- 6 Min. Lesezeit

Perlen, Pfannen, Pfusch: Eine spannende Reise zum Ursprung deutscher Redewendungen
Gibt es eine Redewendung, die so wild klingt wie „Da wird doch der Hund in der Pfanne verrückt“ – und gleichzeitig so deutsch ist wie Brotzeit? Wer einmal anfängt, in Sprichwörtern zu lesen, merkt schnell: Unsere Alltagssprache ist ein Museum aus Mini-Geschichten, Lautmalerei, Zunftwissen und Aberglauben. Dieser Beitrag hebt den Vorhang: Wir klären die wahrscheinlichsten Ursprünge, zeigen berühmte Streitfälle und machen sichtbar, warum Sprache in Bildern denkt.
Wenn dich solche Deep-Dives faszinieren, abonniere gern meinen monatlichen Newsletter für mehr hintergründige Geschichten, verständlich erklärt – ohne Bullshit-Bingo, dafür mit Quellenliebe.
Tiere, Jagd und ein Hund, der (angeblich) Hopfen heißt
Beginnen wir mit dem Publikumsliebling: „Da wird doch der Hund in der Pfanne verrückt!“ Heute ist das der Ausruf, wenn uns etwas völlig aus der Fassung bringt. Die wahrscheinlichste Spur führt zu Till Eulenspiegel. In einer derberzählten Episode landet – Wortspielalarm – nicht ein echter Hund, sondern „Hopf“ (Hopfen) in der Braupfanne. Aus der Verwechslung entsteht eine groteske Pointe, die später sprichwörtlich wird. Entscheidend ist nicht zoologische Wahrheit, sondern die Erinnerung an eine freche Narrentradition.
Apropos Hunde: „Da liegt der Hund begraben“ klingt düster, meint aber die entscheidende Ursache. Mittelhochdeutsch hunt konnte auch „Schatz“ bedeuten; der „begrabene Hund“ war also das versteckte Gut – sinngleich mit „der Kern der Sache“. Weniger klar ist „Auf den Hund kommen“: Von Pfandleiher-Truhen mit Hundedekor bis zum „Hund“ als Symbol für das Letzte – mehrere Hypothesen konkurrieren, keine gewinnt eindeutig.
Aus der Jagd stammen Formeln wie „durch die Lappen gehen“ (Treibjagd mit Tuchbarrieren), „den Vogel abschießen“ (Schützenfest mit Holzvogel) und „auf der Pirsch sein“ (gesichert jagdsprachlich). Und wenn „die Spatzen es von den Dächern pfeifen“, ist die Sache stadtbekannt – das Bild ist alt, Luther mochte es schon.
Küche, Kehle und die Physik des Fettnäpfchens
Sprache riecht manchmal nach Küche. „Den Löffel abgeben“ bedeutet heute sterben, spielte aber einst auf die ganz wörtliche Realität an, dass man im Kloster oder Bauernhaus seinen eigenen Löffel hatte. Wer starb, gab ihn weiter – nüchtern, ohne Pathos. „Ins Fettnäpfchen treten“ erzählt von Stuben, in denen Schmalztöpfe griffbereit standen. Ein Schritt daneben – und schon war der Fauxpas nicht nur sozial, sondern auch olfaktorisch.
„Seinen Senf dazugeben“? Senf war das aufdringliche Gewürz, das überall draufkam, ob’s passte oder nicht. „Reinen Wein einschenken“ ist die Gegenbewegung zu gestrecktem Getränk; „für einen Apfel und ein Ei“ signalisiert Minimalwert. Und „Einen Kater haben“? Das ist kein Tier, sondern ein Burschikos-Witz: aus „Katarrh“ (Erkältung) wurde studentisch „Kater“ – der Rest ist Kopfschmerzgeschichte.
Manches bleibt Volksetymologie: Die „beleidigte Leberwurst“ spielt mit der vormodernen Idee, die Leber sei Sitz der Gefühle – dazu kursiert die humorige Geschichte von der platzenden Leberwurst, die „beleidigt“ war, weil sie zuerst gekocht wurde. Wissenschaftlich zwingend ist das nicht, aber kulturhistorisch leuchtet es.
Zünfte, Werkbänke und die Logik von Nägeln mit Köpfen
Wer jemals ein Brett befestigt hat, weiß: Nägel brauchen Köpfe. „Nägel mit Köpfen machen“ ist daher eine Handwerkermetapher fürs Gründliche. „Jemanden in die Mangel nehmen“ stammt von der Tuchmangel – eine Walze, die Stoff unter Druck setzt; sprachlich wird daraus das strenge Verhör. „Blaumachen“? Der „Blaue Montag“ der Färber ist die wahrscheinlichste Erklärung: Wenn die in Indigo getränkten Stoffe an der Luft oxidieren, haben Menschen Pause. Aus Arbeitschemie wird Feiertagsgefühl.
„Jemandem über den Löffel barbieren“ führt direkt in die Barbierstube: Ein Löffel im Mund spannte die Wangen, um sauber zu rasieren; übertragen steht das für Übervorteilen – die vertraute Verwandtschaft zu „jemanden über den Tisch ziehen“ ist offensichtlich, auch wenn dessen genaue Herkunft umstritten bleibt. Und: „Lehrgeld zahlen“ ist kein Bild, sondern Zunft-Wirklichkeit – Lehrlinge zahlten wirklich.
Fahnen, Flinten und die Dramaturgie des Aufgebens
Wenn ein Schiff die Segel streicht, gibt es buchstäblich Fahrt auf. Daraus wurde das metaphorische „aufgeben“, ebenso kitsch-heroisch wie „mit wehenden Fahnen untergehen“. „Flagge zeigen“ stammt aus dem Seekriegsrecht – erkennbare Zugehörigkeit war Pflicht. Das moderne „Handtuch werfen“ führt ins Boxen; „auf dem Abstellgleis landen“ in die Eisenbahn. Und wenn jemand „einen Strich durch die Rechnung macht“, erinnert das an kaufmännische Listen oder militärische Operationspläne, die mit einem Strich hinfällig werden.
Protest bekommt seine Bühne in „auf die Barrikaden gehen“ – Revolutionsbilder von 1789 und 1848, so prägnant, dass sie bis in Social-Media-Threads weiterleben. Und die scheinbar skurrile Seglerformel „Mast- und Schotbruch!“ ist die maritime Zwillingsschwester von „Hals- und Beinbruch“ – ironisches Glückwünschen als esoterische Unfallprävention.
Heilige, Sündenböcke und antike Tafeln
Religiöse und rechtliche Bilder sind die Schwergewichte im Ursprung deutscher Redewendungen. „Perlen vor die Säue“ ist direkt biblisch (Mt 7,6). Der „Sündenbock“ führt nach Levitikus 16, wo ein Bock die Sünden in die Wüste trägt. „Vom Saulus zum Paulus“ ist so gesichert wie die Kirchenfenster, in denen die Szene leuchtet.
„Tabula rasa“ ist klassische Bildung in zwei Wörtern: die „geschabte Tafel“, auf der neu geschrieben werden kann. „Die Kirche im Dorf lassen“ mahnt zur Mäßigung – vermutlich aus dem Sinnbild dörflicher Prozessionen, bei denen man’s nicht übertreiben sollte. Und „Den Teufel an die Wand malen“ zeigt Aberglauben in Reinform: Nenne das Böse nicht, sonst kommt es. (Man kennt das aus Kommentarspalten.)
Körper, Medizin und der Moment, wenn die Stimme quakt
„Einen Frosch im Hals haben“ – ja, so fühlt sich Heiserkeit an, wenn Schleim und Uvula sich bemerkbar machen. „Jemandem auf den Zahn fühlen“ kommt aus dem Pferdehandel: Zähne verraten das Alter. „Auf dem Zahnfleisch gehen“ übersetzt körperliche Erschöpfung in ein schmerzhaftes Bild; und „den Kopf waschen“ ist weniger Friseur als moralische Reinigung.
Der Strauß steckt nicht wirklich den Kopf in den Sand; trotzdem wird das Missverständnis zur Metapher fürs Verdrängen. „Mit dem Klammerbeutel gepudert sein“ ist so hübsch wie rätselhaft – wahrscheinlich ein Kinderschreck- oder Hebammenwitz. Solche Formeln zeigen: Nicht jede Etymologie ist messerscharf; manchmal bleibt Sprache ein Augenzwinkern der Geschichte.
Geld, Handel und die Mathematik des Alltags
Wirtschaft spricht in Bildern. „Für bare Münze nehmen“ unterscheidet verlässliche Zahlung vom bloßen Versprechen. „Auf die hohe Kante legen“ verweist auf die Truhe mit Geldfach an der Kante – ein sicherer Ort für Erspartes. „Mit der Tür ins Haus fallen“ spielt auf ungestüme Reisende an, die wörtlich hereinpolterten. „Am Hungertuch nagen“ erinnert an Almosentücher – ein hartes Bild für Not.
Und wenn jemand „Pi mal Daumen“ rechnet, hören wir die Werkstatt: Faustregeln geben grobe Größenordnung. Die mathematische Konstante π kam später als Witz hinzu – hübsch, aber nicht ursächlich. Genau diese Dynamik – spätere Umdeutung – ist typisch für den Bedeutungswandel, der den Ursprung deutscher Redewendungen manchmal verkleidet.
Natur, Hauswirtschaft und der Mut zur Schlichtheit
Manche Bilder sind so anschaulich, dass sie kaum Erklärung brauchen. „Etwas unter den Teppich kehren“ ist buchstäblich die heimliche Beseitigung von Dreck. „Auf keinen grünen Zweig kommen“ setzt Wachstum mit Erfolg gleich; „die Ernte einfahren“ macht den Moment greifbar, in dem Leistung gesichert wird. Wenn jemand „auf dem Trockenen sitzt“, hat er keine Mittel – so wie ein Kahn, der feststeckt, oder Fische ohne Wasser.
Ebenso direkt: „Wie die Made im Speck leben“ – Vorratshaltung liefert die Metapher für Überfluss. Und „Eulen nach Athen tragen“? In der Antike war das schlicht überflüssig: Eulen galten als Symbol der Athene, Athen war also „gut versorgt“.
Sprachspiel, Ironie und die Freude am Unsinn
Manchmal ist die Herkunft „laut“ statt logisch: „Kuddelmuddel“ und „Mucksmäuschenstill“ sind lautmalerisch. „Larifari“, „Firlefanz“, „Kokolores“, „Tinnef“, „Gedöns“ – viele dieser Wörter stammen aus Rotwelsch, Gauner- oder regionaler Kaufmannssprache; Details variieren, der Kern ist klar: ein spielerisches „Nimm das nicht ernst“.
Umstritten bleiben Dauerbrenner wie „Guter Rutsch“. Ist das jiddisch rosch (Anfang) – oder schlicht „rutschen“ als Winterbild? Die Forschung ist vorsichtig, das Feuilleton liebt die jiddische Variante. Ähnlich „Es zieht wie Hechtsuppe“: Eine oft behauptete jiddische Etymologie überzeugt nicht; wahrscheinlich handelt es sich eher um eine scherzhafte Intensivformel. Kurz: Nicht jede schöne Geschichte ist eine wahre Geschichte.
Warum so viele Deutungen? Ein Mini-Methodenkurs
Etymologie ist Detektivarbeit. Idealerweise stützen Belege (früheste Textstellen), Sachgeschichte (z. B. Zunftpraxis) und Sprachlogik einander. Wo Überlieferung dünn ist, bleiben Hypothesen – dann markieren seriöse Nachschlagewerke „umstritten“, „plausibel“ oder „gut belegt“. Genau deshalb findest du hier Hinweise auf den Grad der Sicherheit. Unsere Sprache ist ein Palimpsest: Sie schreibt immer wieder neu über alte Schichten.
Zum Abschluss ein Mini-Glossar „zum Einstecken“, das den Weg vom Fachwort zur Redensart zeigt:
Jägersprache: Lappjagd → „durch die Lappen gehen“, Pulverlunte → „Lunte riechen“.
Seefahrt: Schot, Mast, Flagge → „Mast- und Schotbruch!“, „Flagge zeigen“, „Segel streichen“.
Zünfte/Handwerk: Mangel, Nagelkopf, Lehrgeld → „in die Mangel nehmen“, „Nägel mit Köpfen machen“, „Lehrgeld zahlen“.
Militär: Flinte im Korn, Barrikaden, Strich → „Flinte ins Korn werfen“, „auf die Barrikaden gehen“, „Strich durch die Rechnung“.
Kirche/Antike: „Sündenbock“, „Tabula rasa“, „Saulus→Paulus“.
Medizin/Volksglaube: Leber-Gefühle, „Frosch im Hals“, „Kater“ aus „Katarrh“.
Wenn dir diese Reise durch unser Sprachmuseum gefallen hat, lass gern ein Like da und teile deine Lieblings-Redewendung in den Kommentaren. Für mehr Stoff folg meiner Community hier:
Quellen:
Duden – Redewendungen und sprichwörtliche Redensarten – https://www.duden.de
Redensarten-Index – umfangreiche Belegsammlung – https://www.redensarten-index.de
DWDS – Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache – https://www.dwds.de
Wiktionary – deutschsprachiges Wörterbuch – https://de.wiktionary.org
Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm – https://woerterbuchnetz.de/?sigle=DWB
Röhrich, Lutz: Lexikon der sprichwörtlichen Redensarten – https://www.krimidozent.de/redensarten/ (Bibliographische Übersicht)
Luther-Bibel (Beleg zu Mt 7,6 „Perlen vor die Säue“) – https://www.bibleserver.com/LUT/Matth%C3%A4us7
Wörterbuchnetz – weitere historische Quellen – https://www.woerterbuchnetz.de










































































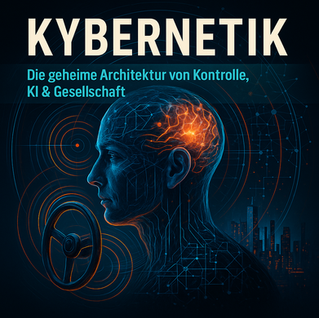

















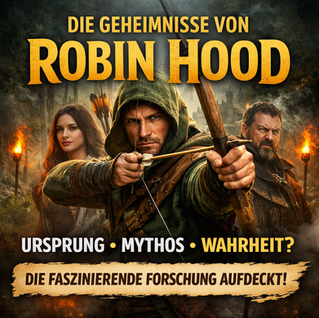





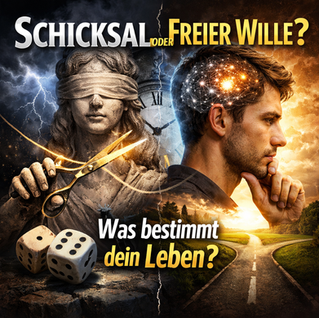








Wundervoll recherchiert ! Ich liebe Redewendungen ! ⭐️👩🏻🦳⭐️