Die Anatomie der Ungleichheit: Warum dein Kontostand mehr über unsere Gesellschaft verrät als über dich
- Benjamin Metzig
- 25. Juli 2025
- 12 Min. Lesezeit

Schau dir mal das Bild oben an. Ernsthaft, nimm dir einen Moment Zeit. Links ein Mann, der auf dem kalten Boden sitzt, die Schultern gebeugt, der Blick gesenkt, alles in düsterem Grau. Rechts ein Mann im schicken Anzug, selbstbewusste Haltung, umgeben von einem warmen, goldenen Licht. Zwei Welten, getrennt durch eine unsichtbare, aber brutal wirksame Linie. Dieses Bild ist mehr als nur ein Symbolbild, es ist die visuelle Essenz einer der grundlegendsten und quälendsten Fragen unserer Zeit: Warum haben einige alles und andere nichts?
Diese Frage bohrt sich tief in unser Gerechtigkeitsempfinden. Wir leben im 21. Jahrhundert, in einer Welt, die global gesehen reicher ist als je zuvor. Und trotzdem klafft die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinander. Ist das Schicksal? Ein Naturgesetz? Das Ergebnis von Fleiß gegen Faulheit? Ich sage euch was: Die Wissenschaft hat eine ziemlich klare, wenn auch unbequeme Antwort darauf. Und die lautet: Nein, nein und nochmal nein.
Die Existenz von Armut und Reichtum ist kein Zufall und auch nicht primär das Ergebnis von individuellem Verdienst oder Versagen. Sie ist das Resultat knallharter Strukturen, historischer Weichenstellungen und politischer Entscheidungen, die ganz systematisch bestimmte Gruppen bevorzugen und andere benachteiligen. Und um das wirklich zu verstehen, müssen wir eine entscheidende, aber oft übersehene Unterscheidung machen: die zwischen Einkommen und Vermögen. Das eine ist der monatliche Gehaltsscheck, das andere ist der riesige Eisberg an Besitz, der darunter liegt und über Generationen hinweg Macht und Chancen zementiert.
Bock auf eine Reise in die Anatomie der Ungleichheit? Auf eine Tour de Force von den Ständegesellschaften über die großen Denker wie Adam Smith und Karl Marx bis hin zu den schockierenden Daten von heute? Dann schnall dich an. Das hier wird keine leichte Kost, aber ich verspreche dir, danach siehst du die Welt mit anderen Augen.
Und wenn dich solche tiefgehenden Analysen, die unseren gesellschaftlichen Code knacken, grundsätzlich fesseln, dann ist mein monatlicher Newsletter genau dein Ding. Trag dich ein und verpasse keine Entdeckungsreise mehr!
Was wir messen, wenn wir von "Arm" und "Reich" sprechen
Bevor wir in die tiefen "Warum"-Fragen eintauchen, müssen wir kurz klären, worüber wir hier eigentlich reden. "Arm" und "reich" sind keine Gefühlszustände, sondern messbare Größen – und wie wir sie messen, verrät schon viel über unsere Gesellschaft.
Auf globaler Ebene geht es ums nackte Überleben. Die Weltbank definiert absolute Armut knallhart: Wer von weniger als 2,15 US-Dollar pro Tag leben muss, gilt als extrem arm. Das ist nicht die Grenze, unter der man sich keinen Urlaub leisten kann, das ist die Grenze zum Verhungern. Nach dieser Definition leben derzeit rund 690 Millionen Menschen in einem Zustand lebensbedrohlichen Mangels an Nahrung, sauberem Wasser und medizinischer Versorgung. In Ländern wie Deutschland ist diese Form der Armut glücklicherweise quasi nicht existent.
Hier bei uns in den Industrienationen sprechen wir von relativer Armut. Dabei geht es nicht mehr ums Überleben, sondern um Teilhabe. Die gängige Definition lautet: Wer weniger als 60 % des mittleren Einkommens der Gesamtbevölkerung zur Verfügung hat, gilt als armutsgefährdet. Das ist keine willkürliche Zahl. Sie markiert die Schwelle, an der es verdammt schwierig wird, am "normalen" gesellschaftlichen Leben teilzunehmen – sei es der Kinobesuch, der Sportverein für die Kinder oder einfach nur die Fähigkeit, eine kaputte Waschmaschine zu ersetzen. In Deutschland betrifft das rund 15 % der Bevölkerung. Ergänzt wird das durch das Konzept der "erheblichen materiellen Entbehrung", das ganz konkrete Dinge abfragt: Kannst du deine Wohnung heizen? Kannst du einmal im Jahr in den Urlaub fahren? Kannst du unvorhergesehene Ausgaben stemmen? Im Jahr 2022 mussten 5,7 Millionen Menschen in Deutschland hier bei mehreren Punkten mit "Nein" antworten.
Am anderen Ende der Skala gilt als (einkommens-)reich, wer mehr als das Doppelte des mittleren Einkommens hat. Doch all diese Zahlen, die sich auf das monatliche Einkommen beziehen, verschleiern das wahre Ausmaß der Spaltung.
Die zwei Gesichter des Geldes: Der gigantische Unterschied zwischen Einkommen und Vermögen
Stell dir dein Geldleben wie eine Badewanne vor. Das Einkommen ist das Wasser, das jeden Monat aus dem Hahn fließt. Es sichert deinen Lebensunterhalt, du bezahlst Miete, Essen, Rechnungen. Das Vermögen ist das Wasser, das bereits in der Wanne ist. Es ist der Gesamtwert von allem, was du besitzt – Immobilien, Aktien, Ersparnisse – abzüglich deiner Schulden. Während der Wasserstrahl aus dem Hahn deinen Alltag bestimmt, ist es der Wasserstand in der Wanne, der dir langfristige Sicherheit, Macht und Einfluss gibt. Und genau hier wird die Ungleichheit in Deutschland geradezu obszön.
Die Messung ist zwar kompliziert, weil Superreiche in Umfragen oft nicht auftauchen oder keine Auskunft geben, aber korrigierte Schätzungen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) zeichnen ein drastisches Bild. Lasst uns die Badewannen-Analogie nochmal bemühen, aber für die ganze Gesellschaft.
Einkommen (der Wasserstrahl): Die reichsten 10 % der Haushalte fangen etwa 30-35 % des gesamten Wasserstrahls auf. Die ärmere Hälfte der Bevölkerung bekommt immerhin noch etwa 20-25 % des Wassers ab. Das ist ungleich, aber noch irgendwie vorstellbar.
Vermögen (das Wasser in der Wanne): Jetzt haltet euch fest. Die reichsten 10 % der Haushalte besitzen unfassbare 60-67 % des gesamten Wassers in der Wanne. Und die ärmere Hälfte der Bevölkerung? Die planscht in den restlichen 1-3 %. Das ist kein Tippfehler. Die reichere Hälfte besitzt 97,5 % des gesamten Vermögens, die ärmere Hälfte muss sich die mickrigen 2,5 % teilen.
Dieser Unterschied ist der Kern des Problems. Vermögen generiert passives Einkommen (Mieten, Zinsen, Dividenden), mit dem man noch mehr Vermögen anhäufen kann. Wer nur von seinem Arbeitseinkommen lebt, kann da niemals mithalten. Der Wasserstand in den Wannen der Reichen steigt also von selbst immer schneller, während die anderen mühsam versuchen, mit ihrem dünnen Wasserstrahl überhaupt den Boden der Wanne zu bedecken. Wer also nur über Einkommensunterschiede redet, kratzt an der Oberfläche eines gigantischen Eisbergs.
Woher kommt das alles? Eine Zeitreise zu den Wurzeln der Ungleichheit
Diese extreme Konzentration von Vermögen ist nicht vom Himmel gefallen. Sie hat eine lange Geschichte, und um sie zu verstehen, müssen wir uns die großen Game-Changer der Wirtschaftsgeschichte ansehen.
Früher, im Feudalismus, war die Sache einfach: Gott wollte es so. Die Gesellschaft war in Stände geordnet – Adel und Kirche besaßen das Land, die Bauern bestellten es in Leibeigenschaft. Ungleichheit war der gottgegebene Normalzustand. Reichtum bedeutete Landbesitz und die Kontrolle über Menschen.
Dann kam die industrielle Revolution im 19. Jahrhundert und wirbelte alles durcheinander. Die feudalen Fesseln fielen, aber an ihre Stelle trat eine neue Form der Ungleichheit: die Klassengesellschaft. Auf der einen Seite die Bourgeoisie, die Bürger, die das Kapital besaßen – Fabriken, Maschinen, Geld. Auf der anderen Seite das Proletariat, die Arbeiter, die nichts besaßen außer ihrer eigenen Arbeitskraft und gezwungen waren, diese zu verkaufen, um zu überleben. Mit diesem Wandel änderte sich auch die Sicht auf Armut. Sie war nicht mehr Schicksal, sondern wurde plötzlich zur moralischen Frage. Arme galten als faul, arbeitsscheu, als selbst schuld an ihrer Misere. Eine Erzählung, die uns bis heute verfolgt.
Dieser Umbruch rief drei Giganten des ökonomischen Denkens auf den Plan, deren Ideen unsere politischen Debatten bis heute prägen:
Adam Smith (Der Optimist): Smith war der Prophet des freien Marktes. Seine Theorie der "unsichtbaren Hand" besagt: Wenn jeder egoistisch seinem eigenen Interesse folgt, dient er am Ende dem Wohl der ganzen Gesellschaft. Freier Wettbewerb und Arbeitsteilung schaffen Wohlstand für alle. Smith war ein Revolutionär, der gegen die ererbten Privilegien des Adels anschrieb. Aber er war kein naiver Marktfanatiker! Er wusste, dass Märkte ein moralisches Fundament aus Fairness und Vertrauen brauchen und forderte staatliche Bildung, um die Abstumpfung der Arbeiter zu verhindern.
Karl Marx (Der Kritiker): Marx sah im Kapitalismus eine Maschine der Selbstzerstörung. Sein Schlüsselbegriff ist der "Mehrwert". Vereinfacht gesagt: Der Arbeiter schafft einen bestimmten Wert, bekommt aber nur einen Lohn, der gerade so zum Überleben reicht. Die Differenz, den Mehrwert, streicht der Kapitalist als Profit ein. Das ist für Marx die Essenz der Ausbeutung. Der Zwang zum Wettbewerb führt laut Marx unweigerlich dazu, dass sich das Kapital in immer weniger Händen konzentriert, während die Masse verelendet. Das System ist für ihn strukturell instabil und zum Scheitern verurteilt.
John Maynard Keynes (Der Retter): Keynes erlebte die Weltwirtschaftskrise 1929 und erkannte: Der Markt heilt sich nicht von selbst. Wenn in einer Krise alle aus Angst sparen, bricht die Nachfrage zusammen und die Wirtschaft stürzt in eine Abwärtsspirale. Seine Lösung: Der Staat muss eingreifen! Er soll in schlechten Zeiten Geld ausgeben (notfalls auf Pump), um die Wirtschaft anzukurbeln und Arbeitsplätze zu schaffen. Keynes lieferte auch die Begründung für Umverteilung: Da ärmere Menschen einen größeren Teil ihres Geldes ausgeben, kurbelt eine Umverteilung von Reich zu Arm die gesamte Wirtschaft an.
Smith, Marx, Keynes – das sind die Pole, zwischen denen sich unsere heutigen wirtschaftspolitischen Debatten bewegen. Deregulierung, radikale Umverteilung oder staatliche Konjunkturprogramme, all diese Ideen haben hier ihre Wurzeln.
Pikettys Schockformel: Wenn Reichtum schneller wächst als Arbeit
Im 21. Jahrhundert hat der französische Ökonom Thomas Piketty diese alten Debatten mit einer Wucht wiederbelebt, die einem intellektuellen Erdbeben glich. Nach der akribischen Auswertung von Steuerdaten aus 200 Jahren fand er eine erschreckend einfache Formel, die die Tendenz des Kapitalismus zur Ungleichheit erklärt: r > g.
Das "r" steht für die durchschnittliche Rendite auf Kapital (also die Gewinne aus Vermögen wie Zinsen, Dividenden, Mieten). Das "g" steht für die Wachstumsrate der Wirtschaft (also das durchschnittliche Wachstum der Einkommen aus Arbeit). Piketty hat gezeigt, dass historisch fast immer r > g galt. Das bedeutet: Vermögen, das einfach nur da ist, vermehrt sich im Schnitt schneller als der Wohlstand, der durch Arbeit geschaffen wird.
Was heißt das konkret? Wenn dein Vermögen schneller wächst als dein Gehalt, dann wird der Anteil des Reichtums, der aus Besitz stammt, immer größer, und der Anteil, der aus Arbeit stammt, immer kleiner. Die logische Konsequenz ist eine immer stärkere Konzentration von Vermögen bei denen, die schon welches haben. Die Gesellschaft kehrt zurück zu einem "patrimonialen Kapitalismus", in dem ererbtes Vermögen wieder wichtiger wird als erarbeiteter Wohlstand. Die kurze Phase relativer Gleichheit nach dem Zweiten Weltkrieg? Eine historische Ausnahme, verursacht durch die Zerstörung von Kapital in zwei Weltkriegen und eine Politik hoher Steuern auf Reichtum danach. Seit den 1980er Jahren sind wir wieder auf dem alten Kurs. Und dieser Kurs bedroht laut Piketty nicht nur die Gerechtigkeit, sondern auch die Demokratie selbst.
Die Ungleichheits-Maschine: Wie Herkunft, Erbe und Globalisierung das Spiel entscheiden
Okay, die historische und theoretische Grundlage haben wir. Aber wie funktioniert diese Ungleichheits-Maschine heute ganz konkret in unserem Alltag? Es sind vor allem drei große Motoren, die dafür sorgen, dass die Kluft immer weiter wächst.
Motor 1: Das Bildungssystem – Der Mythos vom gerechten Aufstieg
Wir alle lieben die Geschichte vom Tellerwäscher, der zum Millionär wird. Sie ist Teil unseres gesellschaftlichen Betriebssystems, des Mythos der Meritokratie: Wer sich anstrengt, kann alles erreichen, egal woher er kommt. Das Bildungssystem soll dafür die faire Startrampe sein. Doch die Daten für Deutschland zeigen: Das ist eine Illusion.
In kaum einem anderen Industrieland hängt der Bildungserfolg so stark von der sozialen Herkunft ab wie bei uns. Das liegt an zwei Effekten:
Primäre Herkunftseffekte: Kinder aus Akademikerfamilien bringen schon zur Einschulung einen größeren Wortschatz und bessere kognitive Fähigkeiten mit. Nicht weil sie schlauer sind, sondern weil sie in einer Umgebung aufwachsen, in der mehr vorgelesen, diskutiert und gefördert wird.
Sekundäre Herkunftseffekte: An den entscheidenden Weichen – vor allem nach der Grundschule – treffen Kinder aus unterschiedlichen Schichten bei gleicher Leistung unterschiedliche Entscheidungen. Ein Arbeiterkind mit guter Note bekommt seltener eine Gymnasialempfehlung als ein Akademikerkind mit derselben Note. Die Eltern trauen es ihrem Kind weniger zu, haben Angst vor den Kosten und können bei Schwierigkeiten weniger helfen.
Das Ergebnis ist ein brutaler Bildungstrichter. Lasst uns das mal durchspielen: Von 100 Kindern aus Akademikerfamilien fangen 79 ein Studium an. Von 100 Kindern aus Nicht-Akademikerfamilien sind es nur 27. Unser Bildungssystem sortiert also nicht nach Talent, sondern reproduziert und legitimiert die soziale Herkunft. Es wäscht den Geburtsvorteil quasi rein und verwandelt ihn in ein scheinbar objektiv verdientes Abschlusszeugnis.
Motor 2: Das Erbe – Wenn Reichtum einfach weitergereicht wird
Während die Bildung die Weichen stellt, zementiert das Erbe die Ungleichheit für die nächste Generation. Jedes Jahr werden in Deutschland bis zu 400 Milliarden Euro vererbt und verschenkt. Eine gigantische Summe. Aber auch hier ist die Verteilung extrem.
Die reichsten 10 Prozent aller Erben bekommen die Hälfte des gesamten Kuchens. Und wer erbt? Überraschung: vor allem die, die sowieso schon reich sind. Kinder aus vermögenden Haushalten erben nicht nur häufiger, sondern auch Summen, die für Kinder aus armen Familien unvorstellbar sind. Das Ergebnis: Der Abstand zwischen denen, die erben, und der großen Mehrheit, die leer ausgeht, wird durch die Erbschaftswelle dramatisch vergrößert. Die Vermögensungleichheit wird so von Generation zu Generation weitergetragen und verfestigt.
Motor 3: Globale Kräfte – Technologie, Handel und koloniales Erbe
Nationale Strukturen werden durch globale Kräfte noch verstärkt. Die Globalisierung und die Digitalisierung haben die Welt reicher gemacht und die absolute Armut reduziert. Aber sie haben auch die Ungleichheit innerhalb der reichen Länder massiv verschärft. Der technologische Wandel belohnt Hochqualifizierte und setzt die Löhne von Geringqualifizierten unter Druck, deren Jobs oft automatisiert oder in Billiglohnländer verlagert werden.
Und diese globalen Prozesse finden nicht auf einem neutralen Spielfeld statt. Sie fußen auf einer tiefen historischen Ungerechtigkeit: dem Kolonialismus. Jahrhundertelang hat Europa den Rest der Welt ausgebeutet und ein System geschaffen, das dem globalen Norden Wohlstand auf Kosten des globalen Südens brachte. Diese Strukturen wirken bis heute fort, im sogenannten Neokolonialismus. Ungerechte Handelsabkommen, die Macht multinationaler Konzerne und die Schuldenlast vieler Entwicklungsländer sorgen dafür, dass die alten Abhängigkeiten bestehen bleiben. Institutionen wie der Internationale Währungsfonds (IWF) oder die Welthandelsorganisation (WTO) reproduzieren diese Machtasymmetrien oft, anstatt sie abzubauen.
Reset-Knopf oder weiter so? Die Politik als Spielmacher
Wenn Armut und Reichtum das Ergebnis von Strukturen und politischen Entscheidungen sind, dann heißt das auch: Wir können sie ändern. Der Staat ist hier kein passiver Zuschauer, sondern der zentrale Schiedsrichter, der die Regeln des Spiels festlegt.
Tatsächlich tut er das schon. Durch Steuern und Sozialleistungen wie Bürgergeld, Rente oder Kindergeld sorgt der Staat für eine erhebliche Umverteilung. Ohne den Sozialstaat wäre die Einkommensungleichheit in Deutschland noch viel dramatischer. Aber das System hat eine gewaltige Schlagseite: Während Einkommen aus Arbeit relativ hoch besteuert wird, werden riesige Vermögen und Erbschaften kaum angetastet. Die effektive Steuerbelastung auf Erbschaften und Schenkungen liegt in Deutschland bei lächerlichen 3 Prozent. Das ist kein Versehen, sondern das Ergebnis von massivem politischem Einfluss.
Die Oxfam-Studie nennt das die "Milliardärsmacht": Extreme Vermögenskonzentration übersetzt sich direkt in politische Macht. Superreiche und Konzerne können durch Lobbyarbeit, Parteispenden und Medienkampagnen die Gesetzgebung in ihrem Sinne beeinflussen – hin zu niedrigeren Steuern für sich selbst und weniger Regulierung. Das ist ein Teufelskreis: Ungleichheit schafft politischen Einfluss, der genutzt wird, um Gesetze zu machen, die die Ungleichheit weiter verschärfen. Das untergräbt das Vertrauen in die Demokratie und bereitet den Boden für Populismus.
Was also tun? Die Analyse zeigt klar die Handlungsfelder:
An der Wurzel ansetzen: Massiv in frühkindliche Bildung und ein gerechteres Schulsystem investieren, um den Zusammenhang von Herkunft und Chancen endlich zu durchbrechen.
Die Verteilung korrigieren: Eine gerechte Steuerreform, die riesige Vermögen und Erbschaften fair besteuert, um die extreme Konzentration zu bremsen und Geld für Zukunftsinvestitionen zu schaffen. Gleichzeitig die Macht der Arbeitnehmer durch starke Tarifverträge und faire Mindestlöhne stärken.
Globale Regeln ändern: International gegen Steuerflucht vorgehen und für eine fairere globale Handels- und Finanzarchitektur kämpfen, die nicht länger die alten kolonialen Muster fortschreibt.
Das war ein Ritt, oder? Wir sind von der Definition von Armut über die Theorien von Marx bis zu globalen Lieferketten und dem deutschen Schulsystem gereist. Die Reise zeigt: Die Kluft zwischen Arm und Reich ist kein Naturgesetz. Sie ist menschengemacht. Und sie ist eine der größten Bedrohungen für unseren sozialen Zusammenhalt und unsere Demokratie. Die entscheidende Frage, die wir uns als Gesellschaft stellen müssen, ist nicht: Können wir uns mehr Gleichheit leisten? Sondern: Können wir uns diese extreme Ungleichheit noch länger leisten?
Mich würde brennend interessieren: Welcher Aspekt hat euch am meisten überrascht oder zum Nachdenken gebracht? War es die krasse Kluft zwischen Einkommen und Vermögen, der Mythos der Leistungsgesellschaft oder Pikettys Formel r > g? Lasst einen Like da, wenn euch der Artikel gefallen hat, und teilt eure Gedanken und Fragen in den Kommentaren!
Und für mehr solchen Stoff, der die Welt hinter den Schlagzeilen erklärt, bleibt dran und folgt unserer Community auf unseren Kanälen. Lasst uns gemeinsam weiterdenken!
#Ungleichheit #Armut #Reichtum #SozialeGerechtigkeit #Piketty #Wissenschaftsjournalismus #Gesellschaft #Wirtschaft #Steuern #Chancengleichheit
Verwendete Quellen:
Wissen kompakt: Armut - Diakonie Deutschland - https://www.diakonie.de/informieren/infothek/wissen-kompakt-armut
Einkommens- und Vermögensungleichheit | Soziale Ungleichheit | bpb.de - https://www.bpb.de/shop/zeitschriften/izpb/soziale-ungleichheit-354/520845/einkommens-und-vermoegensungleichheit/
Das Kapital im 21. Jahrhundert – Wikipedia - https://de.wikipedia.org/wiki/Das_Kapital_im_21._Jahrhundert
Milliardärsmacht beschränken, Demokratie schützen | Oxfam ... - https://www.oxfam.de/publikationen/bericht-soziale-ungleichheit
Einkommens- und Vermögensungleichheit - Empirischer Befund und politische Handlungsoptionen - https://library.fes.de/pdf-files/wiso/15422.pdf
Deutsche unterschätzen ungleiche Verteilung von Einkommen und Vermögen erheblich - https://www.progressives-zentrum.org/publication/deutsche-unterschaetzen-ungleiche-verteilung-von-einkommen-und-vermoegen-erheblich/
Definitionen von Armut. Aktion Deutschland Hilft - https://www.aktion-deutschland-hilft.de/de/fachthemen/armut/armut-was-ist-das-eigentlich/
Poverty, Prosperity, and Planet Report 2024 - World Bank - https://www.worldbank.org/en/publication/poverty-prosperity-and-planet
Armut und Reichtum - Sozialpolitik - https://www.sozialpolitik.com/armut-und-reichtum
Einkommen und Lebensbedingungen, Armutsgefährdung - Statistisches Bundesamt - https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Einkommen-Konsum-Lebensbedingungen/Lebensbedingungen-Armutsgefaehrdung/_inhalt.html
Ungleichheit der Einkommen und Vermögen in Deutschland - Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches Institut - https://www.wsi.de/data/wsimit_2018_05_tiefensee.pdf
MillionärInnen unter dem Mikroskop: Datenlücke bei sehr hohen Vermögen geschlossen – Konzentration höher als bisher ausgewiesen - DIW Berlin - https://www.diw.de/de/diw_01.c.793802.de/publikationen/wochenberichte/2020_29_1/millionaerinnen_unter_dem_mikroskop__datenluecke_bei_sehr_ho___geschlossen______konzentration_hoeher_als_bisher_ausgewiesen.html
Bundesbank-Studie: Vermögen in Deutschland steigen nominal ... - https://www.bundesbank.de/de/aufgaben/themen/bundesbank-studie-vermoegen-in-deutschland-steigen-nominal-gehen-aber-real-zurueck-ungleichheit-bleibt-unveraendert-954622
Sozialgeschichte Mitte des 19. Jahrhunderts | Die Revolution von 1848/49 | bpb.de - https://www.bpb.de/themen/zeit-kulturgeschichte/revolution-1848-1849/517523/sozialgeschichte-mitte-des-19-jahrhunderts/
READ: Smith, Marx, and Keynes (article) | Khan Academy - https://www.khanacademy.org/humanities/big-history-project/acceleration/changing-economies/a/smith-marx-and-keynes
10 facts on global inequality in 2024 - WID - World Inequality Database - https://wid.world/news-article/10-facts-on-global-inequality-in-2024/
Wie ungleich ist die Welt? Ergebnisse des World Inequality Report 2022 - https://www.bpb.de/shop/zeitschriften/apuz/ungleichheit-2022/512778/wie-ungleich-ist-die-welt/
www.ssoar.info Meritokratie als Mythos, Maßstab und Motor gesellschaftlicher Ungleichheit - https://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/65845/ssoar-2019-hillmert-Meritokratie_als_Mythos_Mastab_und.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Soziale Herkunft und Bildung | Soziale Ungleichheit | bpb.de - https://www.bpb.de/shop/zeitschriften/izpb/soziale-ungleichheit-354/520843/soziale-herkunft-und-bildung/
Bildungsbiografie: Wie sehr hängen Bildungsverläufe von der sozialen Herkunft ab? - https://deutsches-schulportal.de/bildungswesen/infografik-kai-maaz-von-welchen-faktoren-haengen-bildungsverlaeufe-ab/
20 Jahre PISA: Soziale Bildungsungleichheit im Fokus - https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/Projekte/Schulische_Bildung/20_Jahre_PISA_Soziale_Bildungsungleichheit.pdf
Hälfte aller Erbschaften und Schenkungen geht an die ... - DIW Berlin - https://www.diw.de/de/diw_01.c.809832.de/publikationen/wochenberichte/2021_05_1/haelfte_aller_erbschaften_und_schenkungen_geht_an_die_reichsten_zehn_prozent_aller_beguenstigten.html
Studie: Erbschaftswelle verschärft Ungleichheit in Deutschland - Beck.de - https://rsw.beck.de/aktuell/daily/meldung/detail/studie-erbschaftswelle-verschaerft-ungleichheit-in-deutschland
Globalisierung, Digitalisierung und ungleiche Einkommen - Bertelsmann Stiftung - https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/unsere-projekte/global-economic-dynamics/projektnachrichten/globalisierung-digitalisierung-und-einkommensungleichheit
Globale Geld- und Warenströme | (Post)kolonialismus und Globalgeschichte | bpb.de - https://www.bpb.de/themen/kolonialismus-imperialismus/postkolonialismus-und-globalgeschichte/231933/globale-geld-und-warenstroeme/
Neokoloniale Wirtschafts- und Handelsbeziehungen - Brot für die Welt - https://www.brot-fuer-die-welt.de/blog/neokoloniale-wirtschafts-und-handelsbeziehungen/
Der Mächtige Einfluss Des IWF: Navigieren In Der Weltwirtschaft - Financial Crime Academy - https://financialcrimeacademy.org/de/der-machtige-einfluss-des-iwf-navigieren-in-der-weltwirtschaft/
Einkommensungleichheit und soziale Mobilität - Bundesfinanzministerium - BMF-Monatsbericht April 2017 - https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2017/04/Inhalte/Kapitel-3-Analysen/3-2-Einkommensungleichheit-und-soziale-Mobilitaet.html
Überlegungen zu Marc Buggelns „Das Versprechen der Gleichheit“ - https://www.netzwerk-steuergerechtigkeit.de/ueberlegungen-zu-marc-buggelns-das-versprechen-der-gleichheit/




























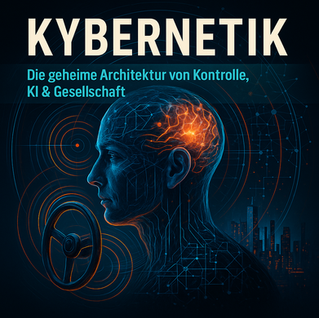

















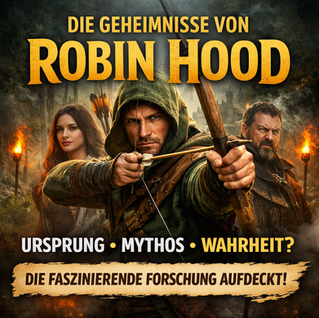





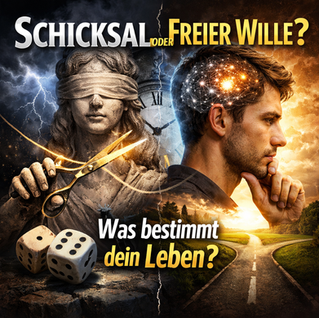









































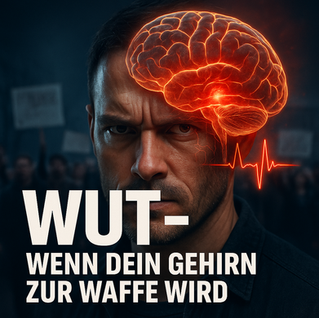












Kommentare