Die dunkle Seite der Macht: Warum Siege ohne Spielfeld zu Niederlagen werden
- Benjamin Metzig
- 18. Aug. 2025
- 8 Min. Lesezeit

Die Szene ist so einfach wie verstörend: Ein König steht glänzend und unversehrt auf einem zerschmetterten Schachbrett. Die rote Glut in den Rissen erinnert an Vulkanschlünde – als hätte die Energie des Sieges das Fundament des Spiels selbst gesprengt. Ein Sieg ohne Mitspieler, ohne Regeln, ohne Feld. Was bleibt dem König? Er herrscht über Asche. Diese Bildmetapher trifft uns deshalb so hart, weil sie einen blinden Fleck unserer Bewunderung entlarvt: Wir feiern Dominanz – und übersehen, dass ungezügelte Macht ihre eigene Lebensgrundlage zerstören kann.
Bevor wir tief eintauchen: Wenn dich solche Analysen faszinieren, abonniere gern meinen monatlichen Newsletter mit pointierten, fundierten Longreads – kompakt, unabhängig, inspirierend.
Das Versprechen dieses Beitrags: Wir entpacken, warum Menschen nach Macht greifen, was Macht mit Gehirn und Persönlichkeit macht, wie sie Moral erodiert – und wie wir sie zähmen können, bevor das Brett bricht. Psychologie trifft Neurowissenschaften, trifft politische Theorie, trifft Literatur und Geschichte. Und ja, wir kehren am Ende zum König auf den Trümmern zurück.
Der versteckte Motor: Warum Machtstreben oft aus Mangel entsteht
Beginnen wir dort, wo Geschichten über Macht selten hinsehen: im Inneren. Alfred Adler, der große Gegenakzent zu Freud, sah nicht die Libido als zentrale Triebkraft, sondern das Geltungsstreben – die Suche nach Überlegenheit als Antwort auf ein universelles, frühes Gefühl von Minderwertigkeit. Kinder sind klein, abhängig, objektiv unterlegen. Aus dieser Erfahrung – so Adler – wächst der Drang, sich zu entwickeln, Fähigkeiten zu entfalten, Defizite zu kompensieren. Das ist nicht pathologisch, sondern die Wiege von Kultur und Fortschritt.
Entscheidend ist der Weg, den dieses Streben nimmt. Gelingt die Einbettung ins „Gemeinschaftsgefühl“, wird persönlicher Aufstieg zum Dienst an der Sache: Kompetenz im Sinne anderer. Kippt die Balance, löst sich das Geltungsstreben vom sozialen Interesse – und wird zum kalten Selbstzweck. Dann wird Macht zum Betäubungsmittel gegen innere Leere: Kontrolle über andere soll Ohnmacht im Inneren dämpfen. Das Problem? Externe Kontrolle kann ein internes Loch nicht füllen. Also braucht es mehr. Und mehr. Und noch mehr. Ein Kreislauf entsteht, der Missbrauch begünstigt und Beziehungen vernutzt.
Verwandt dazu: Narzissmus. In der Umgangssprache „Selbstverliebtheit“, in der Psychologie eine fragile Grandiosität, die ständig durch Bewunderung stabilisiert werden muss – bei Empathiedefizit. Machtpositionen bieten dafür die perfekte Bühne: Publikum, Sichtbarkeit, Steuerungsmacht. Die Forschung differenziert agentische (glänzen, performen), antagonistische (abwerten, dominieren), „kommunale“ (sich altruistisch inszenieren) und neurotische (Opferstatus ausstellen) Facetten. Vier Wege, ein Ziel: ein wackliges Selbst stabilisieren. Die Pointe ist bitter: Gerade jene, die am dringendsten nach Macht dürsten, sind oft am schlechtesten für ihren verantwortlichen Einsatz geeignet.
Ein dritter Blick kommt aus der Motivationspsychologie. Neben Leistung und Anschluss gehört Macht zu den „Großen Drei“. Interessant: In großangelegten Auswertungen dominiert das Machtmotiv häufiger als Leistung oder Anschluss – nur sprechen die wenigsten offen darüber. Wichtig ist die Richtung: „Hoffnung auf Kontrolle“ kann Führung befeuern; „Furcht vor Kontrollverlust“ erzeugt Defensive, Paranoia, Rivaleneliminierung. Das ist das Reagenzglas, in dem die dunkle Seite gärt.
Was Macht mit uns macht: Neuropsychologie eines Rausches
Was passiert, wenn Menschen Macht haben? Nicht nur moralische Appelle ändern sich – die Biologie tut es auch. Experimente zeigen: Wer sich mächtig fühlt, zeigt eine gedämpfte spontane Resonanz auf andere. Übersetzt: Unser internes „Mitschwingen“ – die Grundlage intuitiver Perspektivübernahme – wird leiser. Empathie erlahmt. Das ist keine Ausrede, aber ein Warnschild: Macht wirkt auf Körper und Geist. Dacher Keltner sprach vom „Macht-Paradoxon“: Eigenschaften wie Empathie, Kooperation und Großzügigkeit helfen beim Aufstieg – und erodieren, sobald wir oben sind.
Parallel verzerrt sich Wahrnehmung. Mächtige überschätzen die Wahlfreiheit anderer („Choice-Mindset“): „Wenn ich kann, können die doch auch!“ Das führt zu härteren Urteilen, härteren Strafen, weniger Kontext. Zudem entsteht kognitive Distanz: Menschen werden zu Mitteln, nicht Zwecken. Wer aus der Vogelperspektive denkt, sieht die Karte – aber nicht mehr die Gesichter auf dem Feld.
Und es gibt den Rausch. Macht aktiviert Belohnungssysteme, hebt Stimmung, senkt Angst – Dopamin arbeitet Überstunden. Das enthemmt, erhöht Risikobereitschaft, begünstigt Regelbrüche. Wer sich unangreifbar fühlt, unterbricht häufiger, dringt in Räume ein, testet Grenzen. In Extremfällen kippt das in Größenwahn: Schlaf wenig, rede viel, glaub dich unfehlbar. Das ist kein Shakespeare – das ist Psychophysiologie.
Was daraus entsteht, ist eine Spirale: Weniger Empathie erleichtert härtere Entscheidungen, Belohnung durch Kontrolle verstärkt das Verhalten, Distanz legitimiert es. Jede Runde macht die nächste wahrscheinlicher. Wer führen will, muss diese Spirale kennen – und aktiv brechen.
Die dunkle Seite der Macht – von der Theorie zur Tyrannei
Hier setzen zwei Klassiker an: Lord Acton und Niccolò Machiavelli. Acton, der Historiker, prägte den Satz, der in keinem Politikseminar fehlt: „Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely.“ Wichtig ist sein Kontext: Er forderte, mächtige Figuren mit strengeren moralischen Maßstäben zu messen, gerade weil ihnen zu Lebzeiten selten Rechenschaft abverlangt wurde. Nicht das Amt heiligt die Person – Institutionen müssen Macht teilen und begrenzen, sonst frisst sie Moral.
Machiavelli dagegen schreibt das Handbuch des politischen Realismus. Sein Fürst muss lernen, „nicht gut zu sein“, wenn es die Umstände erfordern – täuschen, brechen, Furcht priorisieren. Entscheidend ist der Schein von Tugend; die Operativsysteme heißen fortuna (Zufall) und virtù (Tatkraft, Kaltblütigkeit). Man muss das nicht mögen – aber psychologisch passt es erschreckend gut zu dem, was wir oben beschrieben haben: Enthemmung, egozentrische Zielverfolgung, Distanz zum moralischen Detail. Machiavelli als frühe Feldstudie der Machtpsychologie.
Korruption ist die praktische Form dieser Erosion: Missbrauch anvertrauter Position zum privaten Vorteil. Sie reicht vom „Gelegenheitsgrapschen“ über planvolle Netzwerke bis zur Systemkorruption, in der „so läuft das hier“ zur Norm wird. Psychologisch hilft sich der Täter durch Rechtfertigungen: „alle machen’s so“, „dient einer höheren Sache“, „ohne mich bricht der Laden zusammen“. Kipnis beschreibt die Eskalation in fünf Stufen: mehr Machtgebrauch, mehr Kontrollempfinden, Abwertung der Untergebenen, Distanz, Selbstüberhöhung. Klingt abstrakt? Schau dir jede große Affäre an – du wirst das Muster finden.
Archetypen auf der Bühne: Macbeth, Michael Corleone – und die Realität
Shakespeares „Macbeth“ verdichtet den Abstieg in poetischer Präzision. Eine Prophezeiung triggert einen latent vorhandenen Ehrgeiz. Lady Macbeth presst Schuld in Mut, Männlichkeit wird zum Hebel. Der Mord an Duncan ist der unumkehrbare Schritt. Danach regiert Paranoia: „Blut will Blut“. Der Held wird Tyrann, isoliert, gejagt von den Konsequenzen seiner Tat. Das Drama ist alt – die Psychologie zeitlos.
Francis Ford Coppolas „Der Pate“ erzählt dieselbe Bahn in modernem Licht. Michael Corleone, der Außenseiter, „Das ist meine Familie, das bin nicht ich“, wird durch den Angriff auf den Vater in den Machtmodus gezwungen – und entdeckt seine Kälte, sein strategisches Genie. Der erste Mord, gerechtfertigt als Schutz, wird zur Türschwelle. Am Ende schützt er nicht mehr die Familie mit Macht – sondern die Macht vor der Familie. Die ikonische Tür schließt sich vor Kay: aus Liebe wird Kalkül, aus Loyalität einsame Herrschaft.
Und die Geschichte? Die totalitären Extreme des 20. Jahrhunderts sind die düstersten Belege für Actons Warnung. Stalins Großer Terror löschte Leben, Vertrauen, Zivilgesellschaft – nicht trotz, sondern wegen der Logik absoluter Kontrolle. Die Roten Khmer trieben die Perversion auf die Spitze: Utopie als Vorwand, Vernichtung als Methode. Aber man muss nicht so weit reisen. Demokratische Systeme kennen ihre eigenen, „banaleren“ Formen: Lobbyismus in Grauzonen, Maskendeals, Koffer voller Bargeld, Chatverläufe, die Karrieren beenden. Nicht spektakulär wie Shakespeare – dafür systemisch und zäh.
Wie wir das Brett retten: Checks, Empathie, Empowerment
Wenn Macht Biologie verbiegt und Systeme verführt – was hilft? Die Antwort ist dreifach.
Erstens: Machtsensibilität. Führung heißt heute auch, die eigenen neuropsychologischen Fallstricke zu kennen. Empathieverlust und Choice-Mindset sind nicht „Charakterschwäche“, sondern vorhersehbare Nebenwirkungen. Wer das weiß, baut Gegenkräfte ein: 360°-Feedback, ungeschönte Sparringspartner, feste Rituale der Perspektivübernahme. Nicht als „Soft Skill“, sondern als kognitive Hygiene. Regelmäßig die Komfortzone verlassen und sich bewusst exponieren – dort, wo man nicht die mächtigste Person im Raum ist.
Zweitens: Strukturen. Acton hatte recht: Tugendappelle reichen nicht. Wir brauchen Gewaltenteilung, unabhängige Justiz, starke Medien und Zivilgesellschaft, Transparenzregeln, Lobbyregister, klare Compliance, interne Revisionen, externe Aufsicht – und internationale Kooperation gegen grenzüberschreitende Geldflüsse. Macht muss geteilt, geprüft, begrenzt werden – auch im Unternehmen: Vier-Augen-Prinzip, rotierende Verantwortlichkeiten, Whistleblower-Schutz, veröffentlichte Nebeneinkünfte und Interessenkonflikte. Kleine Hebel, große Wirkung.
Drittens: Kultur. „Power“ kontrolliert andere; „Empowerment“ teilt Macht und macht andere wirksam. Studien zeigen: Partizipation, geteilte Verantwortung, psychologische Sicherheit steigern Leistung und verringern Missbrauch. Praktisch heißt das: Entscheidungsrechte dezentralisieren, Informationen standardmäßig offenlegen, Erfolge teambasiert attributieren, Fehlertoleranz institutionalisiert (kein „shoot the messenger“). Empathie lässt sich trainieren – Perspektivwechsel, Achtsamkeit, Coaching. Es geht nicht um Nettigkeit, sondern um bessere, robustere Entscheidungen.
Wenn du tiefer in diese Themen eintauchen willst oder unsere Community unterstützen magst – auf Instagram, Facebook und YouTube gibt’s regelmäßig neue Formate, Short Explainers und Debatten:
Die dunkle Seite der Macht im Spiegel der Metapher
Jetzt sind wir wieder beim König auf den Trümmern. Die brutale Einsicht: Ein Sieg, der das Spielfeld zerstört, ist kein Sieg. Führung misst sich nicht daran, alle Figuren vom Brett zu fegen, sondern daran, das Brett intakt zu halten – Regeln, Vertrauen, Institutionen, Würde. Die größte Meisterschaft ist, der eigenen Hybris zu widerstehen. Das ist schwer. Biologie, Psychologie und Systeme arbeiten gegen uns. Aber genau deshalb ist es Führung.
Welche Hebel nimmst du in die Hand – bei dir, in deinem Team, in deiner Organisation? Teile deine Gedanken gern unten in den Kommentaren. Wenn dir dieser Deep Dive gefallen hat, lass ein Like da – das hilft, dass mehr Menschen solche Analysen finden.
Praktische Gegenmittel im Überblick (kurz & konkret)
Regelmäßiges, anonymes 360°-Feedback einführen – mit Veröffentlichung der Maßnahmen, nicht der Noten.
Entscheidungs-„Pre-Mortems“: systematisch Perspektiven einholen, die erklären, warum ein Plan scheitern könnte.
Rotierende Macht: temporäre Leitungsmandate, klare Amtszeiten, Stellvertretungen mit echten Rechten.
Transparenz by default: Lobbykontakte, Nebentätigkeiten, Budgets, Meetingprotokolle – öffentlich oder intern leicht zugänglich.
Whistleblower schützen: sichere Kanäle, Anti-Repressalien-Policy, Belohnung von Aufdeckung statt Bestrafung.
Empathie trainieren: Perspektivwechsel-Übungen, Mentoring „reverse“ (Chef ist Mentee), regelmäßige „Listen-only“-Formate.
Schlussakkord: Jenseits des Sieges
Die dunkle Seite der Macht ist kein Mythos, sondern ein Mechanismus. Sie beginnt im Innen, verstärkt sich durchs Außen – und frisst beides auf. Aber: Sie ist zähmbar. Durch Menschen, die sich selbst ernsthaft prüfen. Durch Institutionen, die nicht auf Güte wetten, sondern auf Begrenzung setzen. Durch Kulturen, die nicht Dominanz prämieren, sondern geteilte Wirksamkeit. Der wahre Triumph ist nicht der einsame König auf Schutt – sondern ein lebendiges Brett, auf dem viele gut spielen können.
Wenn du bis hierhin gelesen hast: Danke. Abonniere gern den Newsletter für mehr solcher Recherchen und Erzählungen – und diskutier mit. Welche Beispiele kennst du, bei denen Macht klug gezähmt wurde?
Quellen:
Macht – Pschyrembel Online – https://www.pschyrembel.de/Macht/T02KQ
Adler – Psychologie: Machtstreben – textlog.de – https://www.textlog.de/adler-psychologie-machtstreben.html
Die Individualpsychologie von Alfred Adler – bruehlmeier.info – https://www.bruehlmeier.info/texte/psychologie/die-individualpsychologie-von-alfred-adler/
Individualpsychologie Alfred Adlers (Einführung) – Adler-Institut Mainz (PDF) – https://www.adler-institut-mainz.de/uploads/media/Individualpsychologie.pdf
Narzissmus – AOK Sachsen-Anhalt – https://www.deine-gesundheitswelt.de/krankheit-behandlung-und-pflege/narzissmus
„Narzissmus hat viele Gesichter“ – Universität Potsdam – https://www.uni-potsdam.de/de/nachrichten/detail/2025-01-21-narzissmus-hat-viele-gesichter-dr-ramzi-fatfouta-ueber-die-unbekannten-seiten
Machtmotivation – Wikipedia – https://de.wikipedia.org/wiki/Machtmotivation
Wie beeinflussen Motive das Führungsverhalten? – allgemeine-psychologie.info (PDF) – https://www.allgemeine-psychologie.info/cms/images/stories/allgpsy_journal/Vol%205%20No%202/Furtner.pdf
Fast 60 Prozent der Angestellten streben in erster Linie nach Macht – PAWLIK Executive – https://pawlik-executive.com/streben-nach-macht/
Warum Macht den Charakter verdirbt — Business Insider – https://www.businessinsider.de/karriere/warum-macht-den-charakter-verdirbt-und-wie-sich-das-verhindern-laesst-a/
Frontotemporale Demenz (Empathieverlust) – AFI – https://www.alzheimer-forschung.de/demenz/formen/frontotemporale-demenz/
socialnet Materialien: Machtsensibilität – https://www.socialnet.de/materialien/29731.php
Machtausübung oder Einflussnahme – HU Berlin (PDF) – https://www.psychology.hu-berlin.de/de/prof/org/download/MachtEinfluss/@@download/file/Machtaus%C3%BCbung%20oder%20Einflussnahme_SCHOLL.pdf
John Emerich Edward Dalberg-Acton – Wikipedia – https://de.wikipedia.org/wiki/John_Emerich_Edward_Dalberg-Acton,_1._Baron_Acton
Lord Acton writes to Bishop Creighton – Liberty Fund – https://oll.libertyfund.org/quotes/lord-acton-writes-to-bishop-creighton-that-the-same-moral-standards-should-be-applied-to-all-men-political-and-religious-leaders-included-especially-since-power-tends-to-corrupt-and-absolute-power-corrupts-absolutely-1887
Acton, letter on historical integrity, 1887 – Hanover College – https://history.hanover.edu/courses/excerpts/165acton.html
Niccolò Machiavelli: Der Fürst – Geschichte kompakt – https://www.geschichte-abitur.de/staatstheorien-der-aufklaerung/niccolo-machiavelli-der-fuerst
Der Fürst – getAbstract (Zusammenfassung) – https://www.getabstract.com/de/zusammenfassung/der-fuerst/48129
Themenschwerpunkt: Psychologische Aspekte von Korruption – Transparency Deutschland (PDF) – https://www.transparency.de/fileadmin/Redaktion/Publikationen/2014/Scheinwerfer_63_II_2014_Psychologische_Aspekte.pdf
Korruption in Deutschland und ihre strafrechtliche Kontrolle – BKA (PDF) – https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/Publikationsreihen/PolizeiUndForschung/1_18_KorruptionInDeutschlandUndIhreStrafrechtlicheKontrolle.pdf
Macbeth and the Nature of Evil – Utah Shakespeare Festival – https://www.bard.org/study-guides/macbeth-and-the-nature-of-evil/
Michael Corleone’s Arc in „The Godfather“ – No Film School – https://nofilmschool.com/michael-corleone-character-arc
Great Purge – Britannica – https://www.britannica.com/event/Great-Purge
Khmer Rouge – History.com – https://www.history.com/articles/the-khmer-rouge
Cambodian genocide – Wikipedia – https://en.wikipedia.org/wiki/Cambodian_genocide
Power oder Empowerment? – Wirtschaftspsychologie Aktuell – https://wirtschaftspsychologie-aktuell.de/magazin/fuehrung/power-oder-empowerment-die-psychologie-der-macht




























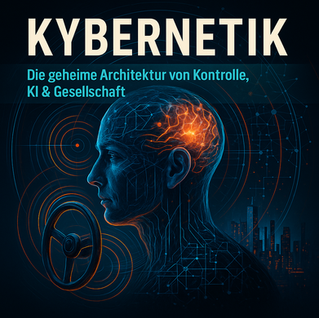

















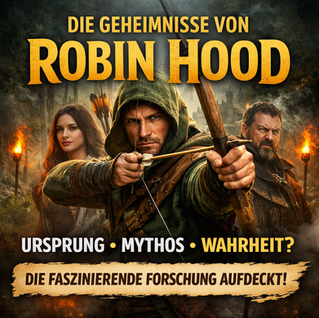





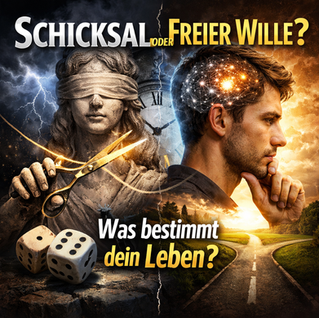









































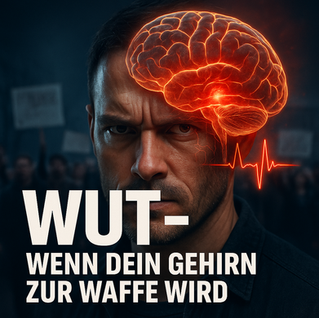












Kommentare