Profit und Verbrechen: Wie tief waren deutsche Firmen wirklich in der NS-Zeit verstrickt?
- Benjamin Metzig
- 7. Aug. 2025
- 9 Min. Lesezeit

Von Zwangsarbeit zu Weltkonzernen: Die schockierende Wahrheit über deutsche Firmen in der NS-Zeit
Ihr fahrt in eurem VW zur Arbeit, kauft bei der Deutschen Bank Aktien oder esst einen Keks von Bahlsen. Das sind Markennamen, die tief in unserem Alltag verankert sind. Sie stehen für Qualität, Erfolg, für das deutsche Wirtschaftswunder. Aber was, wenn ich euch sage, dass hinter diesen glänzenden Fassaden ein dunkles Kapitel schlummert? Eine Geschichte, die nicht von Innovation und Fleiß allein erzählt, sondern von Zwangsarbeit, Enteignung und einer tiefen, schrecklichen Verstrickung in eines der dunkelsten Regime der Menschheitsgeschichte.
Wir begeben uns heute auf eine Reise, die unbequem ist, aber absolut notwendig. Wir ziehen den Vorhang zurück und schauen uns an, was viele jahrzehntelang lieber vergessen wollten: die Rolle, die einige der größten deutschen Unternehmen im Nationalsozialismus spielten. Das ist keine einfache Schwarz-Weiß-Geschichte von Gut und Böse. Es ist eine komplexe Erzählung von Opportunismus, ideologischer Überzeugung, brutalem Profitstreben und einem langen, steinigen Weg der Aufarbeitung. Seid ihr bereit? Es wird intensiv, aber ich verspreche euch, es lohnt sich.
Und wenn ihr nach diesem Artikel noch mehr tiefgründige Einblicke in die Schnittstellen von Wissenschaft, Geschichte und Gesellschaft wollt, dann abonniert unbedingt unseren monatlichen Newsletter! Wir liefern euch die faszinierendsten Geschichten direkt ins Postfach.
Der Pakt mit dem Teufel: Wie die deutsche Wirtschaft auf Kriegskurs ging
Um zu verstehen, wie Konzerne wie Siemens, Krupp oder VW zu integralen Bestandteilen der NS-Kriegsmaschinerie werden konnten, müssen wir zurück ins Jahr 1933. Deutschland liegt wirtschaftlich am Boden, die Weltwirtschaftskrise hat tiefe Spuren hinterlassen. Und dann kommt ein Regime an die Macht, das eine schnelle Lösung verspricht: massive staatliche Investitionen. Doch wohin floss das Geld? Praktisch ausschließlich in die Aufrüstung.
Für die deutsche Industrie war das wie ein Goldrausch. Plötzlich gab es Aufträge in Hülle und Fülle. Die Umsätze explodierten. Siemens zum Beispiel verzeichnete ab 1934 „anhaltend wachsende Umsätze“, die während des Krieges ihre absoluten Höchstwerte erreichten – angetrieben durch Aufträge der Wehrmacht. Es war ein scheinbar unwiderstehliches Angebot: wirtschaftlicher Aufschwung im Tausch gegen die Produktion für den Krieg. Ein klassischer faustischer Pakt.
Doch es war mehr als nur das stille Annehmen von Aufträgen. Die Führungsetagen der Industrie wurden aktiv in die Kriegsplanung eingebunden. Top-Manager wurden zu sogenannten „Wehrwirtschaftsführern“ ernannt, eine Bezeichnung, die die Verschmelzung von unternehmerischer und militärischer Macht perfekt auf den Punkt bringt. Einige Unternehmer waren nicht nur Profiteure, sondern glühende Verfechter der NS-Ideologie. Die Patriarchen der Reimann-Familie, die heute hinter einem riesigen Konsumgüterimperium steht, waren laut historischen Studien „überzeugte Nationalsozialisten und Antisemiten“. Alfried Krupp von Bohlen und Halbach, Erbe des Stahlgiganten Krupp, war schon seit 1931 ein „förderndes Mitglied der SS“. Hier ging es also nicht nur ums Geschäft. Es ging um Überzeugung und aktive Unterstützung.
Historiker betonen heute, dass Unternehmen in einem totalitären Staat kaum die Wahl hatten, Zwangsarbeiter abzulehnen. Aber, und das ist der entscheidende Punkt, den der Historiker Joachim Scholtyseck bei seiner Untersuchung der Quandt-Familie herausarbeitete: „Aber es kam darauf an, wie man diese Zwangsarbeiter beschäftigt hat. Es gab Handlungsspielräume.“ Diese Spielräume, die über Leben und Tod entscheiden konnten – ob ein Mensch eine Scheibe Brot mehr oder weniger bekam –, wurden in vielen Fällen nicht genutzt. Im Gegenteil.
Die zwei Säulen der Ausbeutung: Zwangsarbeit und „Arisierung“
Die dunkle Vergangenheit dieser Unternehmen ruht auf zwei monströsen Säulen, die wir uns jetzt genauer ansehen müssen: der systematischen Ausbeutung von Menschen durch Zwangsarbeit und dem legalisierten Raub jüdischen Eigentums, der „Arisierung“.
Das System der Zwangsarbeit: Eine Hierarchie des Leidens
Stellt euch eine gigantische, unsichtbare Maschine vor, die über 13 Millionen Menschen aus ganz Europa verschluckt und in die Fabriken, auf die Felder und in die Bergwerke des Deutschen Reiches spuckt. Das war die Zwangsarbeit im Nationalsozialismus. Ohne diese Menschen – Zivilisten aus besetzten Gebieten, Kriegsgefangene, KZ-Häftlinge – wäre die deutsche Kriegsmaschinerie und die Versorgung der Bevölkerung zusammengebrochen.
Die Allgegenwart dieses Systems ist erschütternd. Die „Lagerdatenbank“ des Dokumentationszentrums NS-Zwangsarbeit listet allein für Berlin unzählige Firmen auf, die eigene Lager betrieben: Siemens, AEG, Daimler-Benz, ja sogar der Kosmetikhersteller Hans Schwarzkopf. Die Zahlen sind kaum fassbar:
Volkswagen setzte rund 20.000 Zwangsarbeiter ein, darunter 5.000 Häftlinge aus Konzentrationslagern. Zeitweise waren über zwei Drittel der Belegschaft keine freien Arbeiter.
Siemens beschäftigte zwischen 1940 und 1945 mindestens 80.000 Zwangsarbeiter.
Der Stahlkonzern Krupp hatte an einem einzigen Stichtag im Jahr 1943 rund 25.000 Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter im Einsatz.
Selbst Traditionsunternehmen wie der Kekshersteller Bahlsen (ca. 785 Zwangsarbeiterinnen aus Polen und der Ukraine) oder die Firma Benckiser der Reimann-Familie (über 800 Zwangsarbeiter) waren tief verstrickt.
Doch Zwangsarbeiter war nicht gleich Zwangsarbeiter. Das NS-Regime etablierte eine perverse, rassistische Hierarchie des Leidens. Während westeuropäische Facharbeiter manchmal unter vergleichsweise erträglicheren (aber immer noch menschenunwürdigen) Bedingungen litten, traf es Menschen aus Polen und der Sowjetunion, die sogenannten „Ostarbeiter“, am härtesten. Sie mussten diskriminierende Aufnäher tragen („P“ oder „OST“), waren der Willkür der Gestapo schutzlos ausgeliefert und lebten unter katastrophalen Bedingungen.
Eine Überlebende beschrieb ihre Unterkunft als etwas, das man eher mit „Schweine- oder Kuhställen“ vergleichen könne. Die Ernährung bestand oft „die ganze Zeit nur aus Steckrüben“. Das Schlimmste aber war das Schicksal der Häftlinge aus den Konzentrationslagern. Für sie galt die zynische Doktrin der „Vernichtung durch Arbeit“. Unternehmen wie die I.G. Farben oder Siemens betrieben Fertigungsstätten direkt neben Konzentrationslagern wie Auschwitz oder Ravensbrück, wo Tausende, vor allem Frauen, in der Rüstungsproduktion zu Tode geschunden wurden.
Das wohl erschütterndste Beispiel für die Abgründe unternehmerischer Mittäterschaft liefert Volkswagen. Der Konzern betrieb sogenannte „Ausländerkinder-Pflegestätten“. Im Lager Rühen starben mindestens 365 Säuglinge und Kleinkinder von Zwangsarbeiterinnen. Der Grund: „kalkulierte Vernachlässigung“. Man ließ sie systematisch verhungern und an Krankheiten sterben. Der Gipfel des Zynismus: Volkswagen zog den trauernden Müttern die Kosten für die Beerdigung ihrer eigenen Kinder vom kargen Lohn ab. Hier verschwimmt die Grenze zwischen Profitmaximierung und aktiver Teilnahme am Völkermord.
„Arisierung“: Der staatlich organisierte Raubzug
Die zweite Säule der Verstrickung war die „Arisierung“. Ein bürokratischer Begriff für einen brutalen Prozess: die systematische Plünderung und Enteignung jüdischen Eigentums. Von 1933 bis 1945 wurden jüdische Unternehmen, Immobilien, Aktien und Kunstwerke zwangsweise in „arisches“, also nicht-jüdisches, Eigentum überführt.
Das lief in zwei Phasen ab. Zuerst kam der „freiwillige“ Verkauf. Jüdische Geschäftsleute wurden durch Boykotte („Kauft nicht bei Juden!“) und Schikanen in den Ruin getrieben und gezwungen, ihre Firmen weit unter Wert zu verkaufen. Nach den Novemberpogromen 1938 wurde der Prozess dann zur reinen Zwangsenteignung. Neue Gesetze legalisierten den Raub. Jüdisches Vermögen musste angemeldet werden, Betriebe wurden geschlossen, Juden aus dem Wirtschaftsleben verbannt.
Wer profitierte davon? An erster Stelle der Staat selbst, der Milliarden Reichsmark einnahm. Aber eben auch private Unternehmen und Einzelpersonen. Konkurrenten übernahmen jüdische Geschäfte, Ärzte und Anwälte die Praxen ihrer jüdischen Kollegen. Und die Banken? Sie spielten eine Schlüsselrolle. Sie verwalteten die Transaktionen, gaben den „arischen“ Käufern Kredite und lieferten den Behörden Listen mit jüdischen Kontoinhabern. Sie waren die Finanzdienstleister des Diebstahls.
Ein Paradebeispiel ist die Rolle der Deutschen Bank bei der Zerschlagung des renommierten jüdischen Bankhauses Mendelssohn & Co. Die Deutsche Bank „übernahm vollständig“ das traditionsreiche Institut. Die jüdischen Partner wurden gezwungen, ihre Anteile entschädigungslos abzugeben. Ein traditionsreiches Bankhaus, 1795 gegründet, wurde einfach ausradiert – und die Deutsche Bank profitierte direkt davon. Für die jüdische Bevölkerung bedeutete die „Arisierung“ den totalen wirtschaftlichen Ruin. Es war der erste Schritt auf dem Weg in die Vernichtungslager – die Enteignung des Besitzes vor der Vernichtung des Lebens.
Fallstudien: Das Erbe der deutschen Firmen in der NS-Zeit
Schauen wir uns einige dieser Unternehmen genauer an. Ihre Geschichten zeigen, wie unterschiedlich die Verstrickung war – und wie verschieden der Weg der Aufarbeitung bis heute verläuft.
Die Giganten der Industrie: VW, ThyssenKrupp & Siemens
Volkswagen ist vielleicht das ambivalenteste Beispiel. Gegründet als Prestigeprojekt der Nazis, wurde es zum Rüstungsmotor mit Tausenden Zwangsarbeitern und dem schrecklichen Kinderlager in Rühen. Nach dem Krieg dauerte es Jahrzehnte, doch heute gilt die Aufarbeitung von VW als vorbildlich. Angetrieben auch durch die Arbeitnehmervertretung, richtete der Konzern schon 1998 einen Fonds zur Entschädigung ein, hat seine Archive geöffnet, eine Gedenkstätte auf dem Werksgelände errichtet und fördert aktiv die Erinnerungsarbeit. Ein Wandel, der zeigt, dass ehrliche Auseinandersetzung möglich ist.
ThyssenKrupp, als Nachfolger der Stahlgiganten Krupp und Hoesch, trägt ein schweres Erbe. Alfried Krupp wurde in den Nürnberger Prozessen als Kriegsverbrecher wegen des Einsatzes von „Sklavenarbeit“ verurteilt. Die Verstrickung war tief und persönlich, gefördert durch die „Lex Krupp“, ein Gesetz, das ihm die alleinige Kontrolle über den Konzern sicherte. Auch hier findet eine Aufarbeitung statt, unter anderem durch ein von der Krupp-Stiftung initiiertes Forschungsprojekt. Dennoch wird kritisiert, dass gerade die Geschichte der Hoesch AG noch nicht vollständig aufgearbeitet ist.
Siemens wiederum zeigt die Komplexität der Situation. Der Konzern war ein Riesenprofiteur der Aufrüstung und setzte Zehntausende Zwangsarbeiter ein, unter anderem im berüchtigten Frauen-KZ Ravensbrück. Gleichzeitig versuchte die damalige Führung unter Carl Friedrich von Siemens, sich auf elektrotechnische Produkte zu beschränken und die Produktion von reinen Waffen abzuwehren – ein kleiner Handlungsspielraum, der aber nichts an der fundamentalen Mitschuld änderte. Heute bekennt sich Siemens, wie viele andere, in einer gemeinsamen Erklärung zur historischen Verantwortung.
Die Marken aus unserem Alltag: Reimann, Quandt & Bahlsen
Die Geschichte der Familie Reimann (heute JAB Holding, u.a. Jacobs Kaffee, Calgon) ist besonders brisant. Die Patriarchen waren überzeugte Nazis und Antisemiten. Erst ein Generationswechsel brachte die Wahrheit ans Licht. Die Reaktion der Familie war dann aber bemerkenswert: Sie beauftragte nicht nur eine schonungslose Studie, sondern stellte der Alfred Landecker Stiftung 250 Millionen Euro zur Verfügung, um Projekte für Demokratie und gegen Rassismus zu fördern. Eine Summe, die im Vergleich zu anderen als sehr großzügig gilt.
Ganz anders die Familie Quandt (BMW, Varta). Ihr Vermögen basiert, so ein Historiker, fundamental auf Zwangsarbeit und Kriegsprofiten. Die Aufarbeitung kam erst spät und unter öffentlichem Druck in Gang. Zunächst gab es aus der Familie Stimmen, man solle die Vergangenheit doch „vergessen“. Später wurde eine Studie beauftragt und eine Stiftung mit 5 Millionen Euro ausgestattet – eine Summe, die viele im Verhältnis zum riesigen Vermögen der Familie als eher bescheiden empfanden.
Und Bahlsen? Der Kekshersteller, dessen Name für Familientradition steht, setzte ebenfalls Hunderte Zwangsarbeiterinnen ein. Auch hier erfolgte die Aufarbeitung zögerlich und erst auf medialen Druck hin. Inzwischen hat das Unternehmen aber ebenfalls Studien in Auftrag gegeben und bekennt sich zu seiner Verantwortung.
Was uns diese Geschichten zeigen? Dass die Verstrickung bis in die Produkte reichte, die wir heute noch kennen und kaufen. Und dass der Wille zur Aufarbeitung oft vom Mut einzelner Nachkommen oder dem Druck der Öffentlichkeit abhing.
Was denkt ihr darüber? Ist es fair, heutige Generationen von Unternehmerfamilien für die Taten ihrer Vorfahren zur Verantwortung zu ziehen? Schreibt es uns in die Kommentare und liked diesen Beitrag, wenn er euch zum Nachdenken angeregt hat!
Der lange Weg zur Verantwortung: Aufarbeitung als Prozess
Jahrzehntelang herrschte nach dem Krieg eine Kultur des Schweigens und Verdrängens. Die offizielle Lesart vieler Unternehmen und Juristen war: Zwangsarbeit war kein „Unrecht“, sondern eine notwendige Maßnahme im Krieg. Entschädigungsansprüche wurden zurückgewiesen.
Erst in den letzten Jahrzehnten hat sich das Blatt gewendet. Ausgelöst durch mutige Journalisten, kritische Historiker, den Druck ehemaliger Opfer und einen Generationswechsel in den Unternehmen selbst, begann eine echte Auseinandersetzung. Die Gründung der Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“ (EVZ) im Jahr 2000 war ein Meilenstein. Finanziert von Staat und Wirtschaft, zahlte sie über 4,4 Milliarden Euro an mehr als 1,6 Millionen ehemalige Zwangsarbeiter. Ein spätes, aber wichtiges Zeichen.
Heute sehen wir eine neue Kultur der Erinnerung. Unternehmen wie VW oder Dr. Oetker werden für ihre offene Aufarbeitung gelobt. Archive werden geöffnet, Gedenkstätten errichtet, Stiftungen gegründet. Ein besonders starkes Signal ist eine gemeinsame Erklärung von 49 deutschen Top-Unternehmen zum 80. Jahrestag des Kriegsendes am 8. Mai 2025. Darin bekennen sie sich klar zu ihrer historischen Verantwortung und sagen: „Es ist für uns nicht vorbei und wird nicht vorbei sein.“
Was bleibt? Die Lehren aus der Vergangenheit
Die Geschichte der deutschen Firmen in der NS-Zeit ist eine eindringliche Warnung. Sie zeigt, wie schnell wirtschaftliche Interessen und unternehmerische Macht mit einer menschenverachtenden Ideologie verschmelzen können, wenn ethische Grenzen fallen. Sie zeigt, dass Profitgier und Opportunismus zu direkter Komplizenschaft bei den schlimmsten Verbrechen führen können.
Die Aufarbeitung ist noch nicht abgeschlossen. Bei einigen Unternehmen, so mahnen Historiker, stehen umfassende Untersuchungen noch aus. Aber der Wandel von der Verleugnung zur Verantwortung ist unverkennbar und ein wichtiger Prozess für unsere gesamte Gesellschaft. Denn nur, wer seine eigene dunkle Geschichte kennt und sich ihr stellt, kann sicherstellen, dass sie sich niemals wiederholt.
Diese Vergangenheit ist nicht nur ein Thema für Historiker. Sie ist ein Teil von uns. Sie steckt in den Fundamenten, auf denen einige der erfolgreichsten Konzerne der Welt aufgebaut sind. Daran zu erinnern, ist keine Schuldzuweisung an die Heutigen, sondern eine Verpflichtung für die Zukunft.
Hat dich dieser tiefe Einblick in ein komplexes Stück deutscher Geschichte fasziniert? Dann folge uns für noch mehr spannende Inhalte und diskutiere mit unserer Community auf unseren Social-Media-Kanälen! Wir freuen uns auf dich!
#Hashtags#DeutscheGeschichte #NSZeit #Zwangsarbeit #Wirtschaftsgeschichte #Unternehmen #Verantwortung #Aufarbeitung #Holocaust #Erinnerungskultur #DeutscheFirmen
Verwendete Quellen:
Bahlsen, Flick und Co. - Wie Familienunternehmen NS-Zwangsarbeit aufarbeiten - https://www.deutschlandfunk.de/bahlsen-flick-und-co-wie-familienunternehmen-ns-100.html
Nationalsozialismus - "Ein paar Unternehmen haben sich ihrer Geschichte noch nicht gestellt" - Deutschlandfunk - https://www.deutschlandfunk.de/nationalsozialismus-ein-paar-unternehmen-haben-sich-ihrer-100.html
Lagerdatenbank - Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit - https://www.ns-zwangsarbeit.de/recherche/lagerdatenbank/
Überblick: Die nationalsozialistische Zwangsarbeit | NS-Zwangsarbeit. Lernen mit Interviews | bpb.de - https://www.bpb.de/themen/nationalsozialismus-zweiter-weltkrieg/ns-zwangsarbeit/222627/ueberblick-die-nationalsozialistische-zwangsarbeit/
Zwangsarbeit in der deutschen Industrie während des NS - Wollheim Memorial - http://www.wollheim-memorial.de/de/zwangsarbeit_in_der_deutschen_industrie_waehrend_des_ns
Ausländerkinder-Pflegeheim des Volkswagenwerks - Wikipedia - https://de.m.wikipedia.org/wiki/Kinderlager_R%C3%BChen
Siemens im Nationalsozialismus - https://www.siemens.com/de/de/unternehmen/konzern/geschichte/stories/siemens-im-nationalsozialismus.html
Alfried Krupp von Bohlen und Halbach - Wikipedia - https://de.wikipedia.org/wiki/Alfried_Krupp_von_Bohlen_und_Halbach
Freiheit, Zwang, Vernichtung: Arbeit und der Nationalsozialismus - Amadeu Antonio Stiftung - https://www.amadeu-antonio-stiftung.de/freiheit-zwang-vernichtung-arbeit-und-der-nationalsozialismus-110901/
Zwangsarbeit für Siemens im Frauenkonzentrationslager Ravensbrück - https://www.ravensbrueck-sbg.de/en/publications/zwangsarbeit-fuer-siemens-im-frauenkonzentrationslager-ravensbrueck/
LeMO Zeitstrahl - NS-Regime - Industrie und Wirtschaft - "Arisierung" - https://www.dhm.de/lemo/kapitel/ns-regime/wirtschaft/arisierung
„Arisierung“ | Holocaust-Enzyklopädie - https://encyclopedia.ushmm.org/content/de/article/aryanization
List of companies involved in the Holocaust - Wikipedia - https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_companies_involved_in_the_Holocaust
Mendelssohn_Co. i. L.CL.pdf - CLAIMS RESOLUTION TRIBUNAL - https://www.crt-ii.org/_awards/_apdfs/Mendelssohn_Co.%20i.%20L.CL.pdf
Wie VW mit seiner Rolle in der NS-Zeit umgeht - Das Parlament - https://www.das-parlament.de/kultur/geschichte/wie-vw-mit-seiner-rolle-in-der-ns-zeit-umgeht
Entschädigung für Zwangsarbeit - Auswärtiges Amt - https://tel-aviv.diplo.de/il-de/service/1605982-1605982
Aufarbeitung der Firmengeschichte: Deutschen Unternehmen während der NS-Zeit - https://www.business-humanrights.org/de/neuste-meldungen/aufarbeitung-der-firmengeschichte-studien-zu-deutschen-unternehmen-w%C3%A4hrend-der-ns-zeit/
Quandt (Familie) - Wikipedia - https://de.wikipedia.org/wiki/Quandt_(Familie)
Erklärung der Unternehmen zum 8. Mai | Rheinmetall - https://www.rheinmetall.com/de/media/news-watch/news/2025/05/2025-05-08-erklaerung-der-unternehmen-zum-8.-mai
Die Erinnerungsstätte an die Zwangsarbeit auf dem Gelände des Volkswagenwerks | Volkswagen Group - https://www.volkswagen-group.com/de/die-erinnerungsstaette-an-die-zwangsarbeit-auf-dem-gelaende-des-volkswagenwerks-15867
Historiker über NS-Profiteure: „Zögerliche Aufarbeitung“ | taz.de - https://taz.de/Historiker-ueber-NS-Profiteure/!5793168/
ThyssenKrupp: Einstige Waffenschmiede und Stahlkonzern - DER SPIEGEL - https://www.spiegel.de/fotostrecke/thyssenkrupp-einstige-waffenschmiede-und-stahlkonzern-fotostrecke-84551.html
Aus der Geschichte lernen - https://uploads.vw-mms.de/system/production/documents/cws/001/758/file_de/d0d5fc9759d26e320e69ba999c408d7974c451ba/Heft1_Aus_der_Geschichte_lernen.pdf?1683795725
Krupp-Prozess - Wikipedia - https://de.wikipedia.org/wiki/Krupp-Prozess
Der lange Weg zur Entschädigung | NS-Zwangsarbeit. Lernen mit - https://www.bpb.de/themen/nationalsozialismus-zweiter-weltkrieg/ns-zwangsarbeit/227273/der-lange-weg-zur-entschaedigung/




























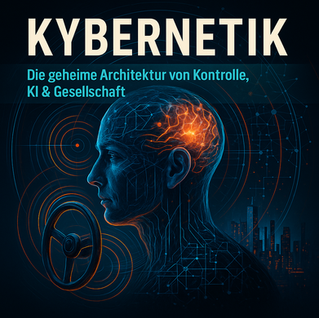

















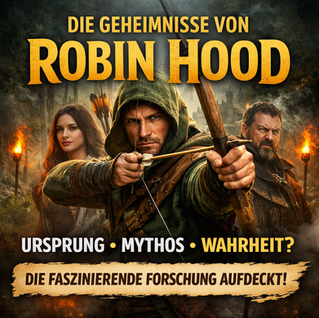





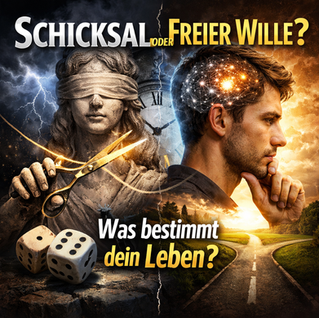









































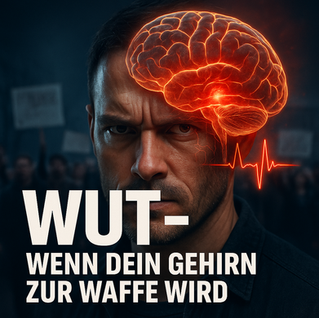












Kommentare