Wie Okkultismus zwischen Wissenschaft und Magie pendelt – und warum er nie verschwindet
- Benjamin Metzig
- 28. Nov. 2025
- 11 Min. Lesezeit

Okkultismus ist nie nur „Hexenzeug“. Er ist Geschichtsunterricht, Psychologie-Seminar, Kunstgeschichte und Internetkultur in einem. Wer sich heute durch #WitchTok swiped, stolpert über Sigillen-Tutorials, „Manifesting“-Challenges und Tarot-Livestreams – und landet mitten in einer Jahrtausende alten Tradition, die sich ständig neu erfindet: Okkultismus zwischen Wissenschaft und Magie.
Wenn dich solche tiefen Tauchgänge in die Schnittstellen von Wissen, Glauben und Kultur faszinieren, abonniere gern meinen monatlichen Newsletter – dort gibt es weitere lange Reads, die genau solche Themen entwirren, ohne den Spaß an der Sache zu verlieren.
Was meinen wir, wenn wir von Okkultismus sprechen?
Im Alltag ist „okkult“ oft ein Sammelbegriff für alles, was düster aussieht, nicht gut erklärbar ist oder irgendwie „magisch“ wirkt. Wissenschaftlich betrachtet ist das deutlich zu unscharf. Der Begriff kommt vom lateinischen occultus – verborgen, verdeckt. Gemeint ist also zunächst nicht „böse“, sondern „unsichtbar“.
Historisch spricht man von scientia occulta oder philosophia occulta: vom Wissen um verborgene Kräfte in Natur, Kosmos und Geist. Im Gegensatz zur modernen Naturwissenschaft, die nur das akzeptiert, was messbar, wiederholbar und überprüfbar ist, befasst sich der Okkultismus mit der „Nachtseite“ der Natur. Er behauptet, es gebe unsichtbare Wirkzusammenhänge, die durch bestimmte Techniken – Rituale, Symbole, Formeln – gezielt beeinflusst werden können.
In der Religionswissenschaft wird Okkultismus meist als Unterkategorie der Esoterik gefasst. Esoterik (vom griechischen esoteros – innerlich) bezeichnet Lehren, die ein verborgenes, inneres Wissen für einen eingeweihten Kreis versprechen. Okkultismus ist in diesem Dachbegriff der „handwerkliche“ Teil: Er beschäftigt sich mit der praktischen Anwendung dieses Geheimwissens. Dazu gehören etwa:
Magie (Ritualmagie, Sigillen, Theurgie)
Astrologie (Deutung von Gestirnpositionen als Ausdruck von Zeitqualität)
Alchemie (Stoff- und Bewusstseinswandlung)
Divination (Weissagung, z.B. Tarot, Pendeln, Runen)
Man könnte zugespitzt sagen: Esoterik will verstehen, Okkultismus will machen.
Abgrenzung zu Religion, Mystik und Esoterik
Damit der Begriff nicht alles und nichts bedeutet, lohnt eine grobe Trennlinie zu verwandten Phänomenen.
Religion richtet sich auf Erlösung, Heil und Gemeinschaft. Zentrale Werkzeuge sind Dogmen, Rituale und der Glaube an eine höhere Instanz, der man sich unterordnet.
Mystik zielt auf die direkte Erfahrung der Einheit mit dem Göttlichen. Sie arbeitet mit Kontemplation, Versenkung und der Auflösung des Ichs – eher passiv, eher nach innen.
Esoterik verspricht Gnosis, also Erkenntnis eines verborgenen Sinns hinter der sichtbaren Welt – meist in symbolischen Systemen, Astrologie, Kabbala, Numerologie.
Okkultismus schließlich will Macht über Abläufe: Schutz errichten, Ereignisse beeinflussen, Energien „kanalisieren“. Er ist technischer, instrumenteller, oft individualistischer als klassische Religion.
Natürlich sind diese Kategorien keine harten Schubladen. Die christliche Kabbala der Renaissance ist zugleich mystisch, esoterisch und magisch. Aber die Tendenz ist klar: Der Mystiker will eins werden, der Okkultist will wissen, wie das Universum funktioniert – und es im Idealfall bedienen wie ein komplexes Gerät.
Der Anspruch, „eigentlich“ Wissenschaft zu sein
Spätestens seit dem 19. Jahrhundert tritt Okkultismus gerne in einem weißen Laborkittel auf – zumindest rhetorisch. Viele Strömungen präsentieren sich als „Geheimwissenschaft“, die dort weitermacht, wo die offizielle Physik angeblich aufgibt. Dämonen heißen dann „Energien“, „Schwingungen“ oder „Quantenfelder“.
Dieses Vokabular ist mehr als Deko. Es soll zwei Welten versöhnen: die Sehnsucht nach Transzendenz und den Status von Wissenschaftlichkeit. Organisationen wie die GWUP (Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften) halten dagegen: In kontrollierten Experimenten verhalten sich Pendel, Tische oder Wünschelruten sehr irdisch – psychologische Effekte wie der ideomotorische Effekt erklären vieles deutlich besser als „Astrallicht“.
Genau in dieser Spannung – wissenschaftliches Flirren im Vokabular, magische Praxis im Kern – liegt der Reiz des Themas Okkultismus zwischen Wissenschaft und Magie.
Hermetik, Gnosis und Kabbala: Die DNA des westlichen Okkultismus
Um zu verstehen, was moderne Hexen, Chaosmagierinnen oder #WitchTok-Creator da eigentlich tun, müssen wir in die Spätantike reisen. Schauplatz: Alexandria, kultureller Großstadtschmelztiegel von griechischer Philosophie, ägyptischer Religion und jüdischer Mystik.
Hier entsteht die Hermetik, benannt nach Hermes Trismegistos, einer Mischfigur aus dem griechischen Hermes und dem ägyptischen Thot. Die Forschung unterscheidet zwei eng verwobene Stränge:
Philosophische Hermetik: Texte wie das Corpus Hermeticum diskutieren Kosmos, Seele und Erlösung. Der Mensch kann durch Erkenntnis (Gnosis) seine göttliche Natur wiederentdecken und aus der materiellen Welt aufsteigen.
Technische Hermetik: Hier wird es „praktisch“: Astrologie, Alchemie, Theurgie. Ziel ist Lebensmeisterung und Naturbeherrschung – also das, was später Okkultismus im engeren Sinne wird.
Das Prinzip der Analogie: „Wie oben, so unten“
Herzstück dieser Tradition ist ein einziger, extrem wirkmächtiger Satz aus der legendären Tabula Smaragdina:
„Was oben ist, ist gleich dem, was unten ist.“
Makrokosmos (Universum, Sterne) und Mikrokosmos (Mensch, Körper, Seele) spiegeln sich. Aus dieser Analogie lassen sich ganze Systeme bauen:
In der Astrologie steht der feurige, rote Mars für Eisen, Blut, Krieger und Aggression.
In der Alchemie symbolisiert der Weg von Blei zu Gold die Läuterung der Seele vom Groben zum Feinen.
In der okkulten Medizin entsprechen äußere Zeichen inneren Zuständen – etwa in der Irisdiagnostik.
Wer dieses Analogiedenken einmal verstanden hat, erkennt es fast überall wieder: im Tarot, in Kabbala-Diagrammen, in New-Age-Büchern und sogar in manchen Self-Help-Coachings.
Gnosis und Kabbala: Landkarten des Unsichtbaren
Zwei weitere Strömungen fließen in dieses Gemisch:
Die Gnosis interpretiert die materielle Welt oft als unvollkommenes Produkt eines niederen Schöpfergottes. Erlösung gibt es nur durch geheimes Wissen – eine Art spiritueller Leak hinter den Kulissen der Realität.
Die Kabbala, ursprünglich jüdische Mystik, wird in der Renaissance von christlichen Gelehrten adaptiert. Ihr Lebensbaum mit zehn Sphären (Sephiroth) wird zur kosmischen Landkarte: von der rohen Materie bis zum reinen Geist.
Später greifen magische Orden wie der Golden Dawn diese Struktur auf: Die Grade der Initiation entsprechen Stationen auf dem kabbalistischen Baum. Wer aufsteigt, „erklimmt“ symbolisch das Universum.
Die okkulte Renaissance des 19. Jahrhunderts
Nach Aufklärung und Rationalismus könnte man meinen: Thema erledigt, Magie abgewählt. Tatsächlich passiert das Gegenteil. Historiker wie James Webb sprechen vom „Zeitalter des Irrationalen“ – einem regelrechten Comeback des Okkulten im 19. Jahrhundert.
Eliphas Lévi: Der Architekt der „Hohen Magie“
Der französische Denker Eliphas Lévi baut in der Mitte des 19. Jahrhunderts eine Art Betriebssystem für den modernen Okkultismus. Er verknüpft Hermetik, Kabbala, Tarot und Magie zu einem konsistenten System.
Seine berühmteste Idee: Die 22 großen Arkana des Tarot entsprechen den 22 hebräischen Buchstaben und den Pfaden des Lebensbaums. Das Tarot wird damit vom Kartenspiel zum symbolischen Handbuch des Kosmos. Lévi spricht von einer universellen Kraft – dem „Astrallicht“ – die Magier nutzen können.
Seine Zeichnung des Baphomet, einer gehörnten Mischgestalt mit Fackel und Frauenkörper, wird zur Ikone. Für Lévi symbolisiert sie das Gleichgewicht der Gegensätze (männlich/weiblich, oben/unten) – in der Popkultur bleibt davon meist nur das „Teufels“-Image übrig.
Spiritismus: Die Demokratisierung des Jenseits
Parallel dazu erobert eine Massenbewegung die Wohnzimmer: der Spiritismus. Tische rücken, Gläser wandern, Buchstaben kreisen. Familien sitzen im Halbdunkel und „sprechen“ mit Verstorbenen.
Allan Kardec, ein französischer Pädagoge, versucht, dieses Phänomen zu systematisieren. Für ihn ist Spiritismus keine Religion, sondern eine „Wissenschaft der Beobachtung“. Reinkarnation und Jenseitskontakte werden zu wiederholbaren Experimenten – zumindest im Selbstverständnis der Bewegung.
Psychologisch lässt sich vieles nüchterner erklären: Der ideomotorische Effekt zeigt, wie unbewusste Muskelbewegungen Objekte scheinbar von Geisterhand bewegen. Trotzdem schafft der Spiritismus etwas Erstaunliches: Er gibt vor allem Frauen eine Stimme als Medien – in einer Zeit, in der sie gesellschaftlich kaum Macht haben.
Helena Blavatsky und die Theosophie
Noch größer wird der kulturelle Impact mit Helena Petrovna Blavatsky. Die russische Adlige gründet 1875 die Theosophische Gesellschaft und mixt westlichen Okkultismus mit Hinduismus und Buddhismus.
Blavatsky behauptet, ihre Lehren von „Mahatmas“, unsichtbaren Meistern in Tibet, telepathisch oder per materialisierten Briefen zu empfangen. Skandale um Fälschungsvorwürfe schaden ihrem Ruf, aber nicht der Attraktivität des Systems: Eine gigantische Kosmologie mit Zyklen, Wurzelrassen und spiritueller Evolution.
Viele spätere Bewegungen – von Rudolf Steiners Anthroposophie bis zur New-Age-Spiritualität der 1970er – wachsen direkt aus dieser theosophischen Erde.
Okkultismus zwischen Wissenschaft und Magie: Praxis, Rituale, Selbstermächtigung
Wenn Begriffe wie „Lebensbaum“ und „Astrallicht“ zu abstrakt wirken, hilft ein Blick auf die konkrete Praxis. Denn Okkultismus zwischen Wissenschaft und Magie spielt sich nicht im luftleeren Theorieraum ab, sondern im Wohnzimmer, im Tempel – und heute auch auf TikTok.
Orden als „spirituelle Universitäten“
Gegen Ende des 19. Jahrhunderts organisieren sich Okkultisten in Orden mit strenger Gradstruktur. Der berühmteste: der Hermetic Order of the Golden Dawn.
Mitglieder – darunter Dichter wie W.B. Yeats oder später Aleister Crowley – durchlaufen ein Curriculum, das fast alles abdeckt: Tarot, Astrologie, Kabbala, Alchemie, Geomantie. Jeder Grad entspricht einer Sphäre auf dem kabbalistischen Baum und einem Element (Erde, Luft, Wasser, Feuer).
Der äußere Orden vermittelt Theorie und symbolisches Denken; im inneren Orden folgen praktische Rituale: Schutzkreise, Skrying (Visionstrancen), Talismanmagie. Der Orden zerbricht an Machtkämpfen, aber seine Struktur lebt in vielen heutigen Traditionen weiter – von Wicca bis Thelema.
Der Ordo Templi Orientis (O.T.O.) schlägt eine verwandte Richtung ein, legt aber einen starken Schwerpunkt auf Sexualmagie. Unter Crowley werden Sexualakte bewusst als energetische „Batterien“ in magische Rituale eingebunden – eine Idee, die bis heute in vielen okkulten Szenen fasziniert und polarisiert.
Crowley, Thelema und Magick
Aleister Crowley selbst stilisiert sich als „Tier 666“ und wird zum Rockstar des Okkultismus. 1904 empfängt er in Kairo das Buch des Gesetzes, diktiert von einem Wesen namens Aiwass. Daraus entsteht Thelema, eine Weltanschauung mit zwei Kernformulierungen:
„Tu, was du willst, soll sein das ganze Gesetz.“„Liebe ist das Gesetz, Liebe unter Willen.“
Gemeint ist nicht beliebige Laune, sondern der „Wahre Wille“ – der individuell passende Lebensweg, den jede Person finden soll. Magie, oder bei Crowley Magick mit k, ist dafür das Werkzeug:
„Magick ist die Wissenschaft und Kunst, Veränderungen in Übereinstimmung mit dem Willen zu bewirken.“
Wissenschaft und Kunst – schon wieder diese Doppelrolle. Crowley arbeitet mit präzisen Ritualprotokollen, experimentiert mit Yoga und Meditation, entwickelt Korrespondenzlisten (Liber 777) und beschreibt psychologisch höchst wirksame Strategien: Wissen, Wollen, Wagen, Schweigen.
Vom Tempel ins Unterbewusstsein: Sigillen und Chaosmagie
Während Crowley aufwändige Zeremonien liebt, geht der Künstler Austin Osman Spare den Gegenweg: radikale Vereinfachung. Für ihn stammen Götter und Dämonen nicht aus anderen Dimensionen, sondern aus den „atavistischen Tiefen“ des Unterbewusstseins.
Sein Werkzeug: Sigillenmagie.
Wunsch formulieren („Ich finde einen Job, der mich erfüllt“).
Doppelte Buchstaben streichen, aus den restlichen eine abstrakte Glyphe formen.
Diese Sigille in einem Zustand extremer Konzentration oder Ekstase ins Unterbewusstsein „laden“.
Danach: Vergessen. Je weniger das Bewusstsein daran klebt, desto eher kann – so die Theorie – das Unterbewusste wirken.
In den 1970ern greifen Chaosmagier diese Methoden auf. Ihre Grundthese: Objektive magische Wahrheiten gibt es nicht, Glaubenssysteme sind Werkzeuge. Heute Cthulhu, morgen Erzengel, übermorgen ein selbst erfundener Meme-Gott – Hauptsache, der psychologische Effekt stimmt.
Magie auf Leinwand und Papier: Okkultismus in Kunst und Literatur
Okkultismus ist nicht nur eine Subkultur im Schatten, er hat die Kunstgeschichte tief geprägt – oft unsichtbar.
Abstrakte Kunst als „sichtbare Unsichtbarkeit“
Die schwedische Malerin Hilma af Klint malt um 1907 große abstrakte Bilder, lange bevor Kandinsky berühmt wird. Sie versteht sich als Medium geistiger Wesen und will mit Farben und Formen spirituelle Realitäten sichtbar machen. Ihre Werke entstehen im Kontext von Spiritismus und Theosophie.
Auch Wassily Kandinsky liest theosophische Schriften und später Rudolf Steiner. In seinem Essay Über das Geistige in der Kunst beschreibt er Farben und Formen als Kräfte mit bestimmten „Schwingungen“ – eine direkte Übertragung esoterischer Aura-Lehren auf die Malerei.
Wer heute in ein Museum für abstrakte Kunst geht, bewegt sich also oft in Räumen, in denen theosophisches und okkultes Denken mitgemalt wurde.
Literatur zwischen Fiktion und Glaubenssystem
Der irische Dichter W.B. Yeats war nicht nur Nobelpreisträger, sondern auch aktiver Magier im Golden Dawn. Sein Werk A Vision basiert auf automatischen Schriften, bei denen seine Frau in Trance Texte „empfängt“. Heraus kommt ein komplexes System aus Zyklen und Mondphasen, das Geschichte und Persönlichkeit deuten soll – genau die Art von Mischform aus Poesie, Systemdenken und Okkultismus, die moderne Leserinnen gleichzeitig fasziniert und ratlos lässt.
Ganz anders H.P. Lovecraft: strenger Materialist, aber Erfinder des fiktiven Zauberbuchs Necronomicon. Ironischerweise wird dieses erfundene Buch später von realen Okkultisten ernst genommen; es gibt heute zahlreiche „Necronomicon“-Ausgaben, die magische Rituale enthalten. Ein schönes Beispiel für „Hyperrealität“: Wenn genug Menschen an etwas Fiktives glauben und entsprechend handeln, wird es sozial real – unabhängig von seinem Ursprung.
Psychologie, Gesellschaft und die Wiederverzauberung der Welt
Warum halten sich okkulte Ideen so hartnäckig – sogar in einer Welt mit Teilchenbeschleunigern, Raumsonden und Quantencomputern?
Entzauberung – und die Gegenbewegung
Der Soziologe Max Weber spricht um 1900 von der „Entzauberung der Welt“: Rationalisierung, Bürokratie und Wissenschaft verdrängen magische Weltbilder. Heute beobachten Forscher jedoch eine Wiederverzauberung.
Klassische Großkirchen verlieren Bindungskraft, aber der Wunsch nach Sinn, Transzendenz und persönlicher Bedeutung bleibt. Der spirituelle „Supermarkt“ bietet Tarot, Yoga, Human Design, Astrologie-Apps und eben magische Praktiken. Okkultismus liefert dabei etwas, das traditionelle Religion oft nicht bieten kann: das Gefühl von Selbstwirksamkeit.
Statt zu beten und auf göttliche Gnade zu hoffen, verspricht ein Ritual: „Wenn du das tust, kannst du dein Schicksal direkt beeinflussen.“ Ob das objektiv stimmt, ist eine andere Frage – psychologisch kann allein das Gefühl, handeln zu können, stabilisierend wirken.
Kognitive Verzerrungen: Wenn das Gehirn Magie bastelt
Aus psychologischer Sicht lässt sich vieles nüchterner erklären, ohne die emotionale Erfahrung kleinzureden. Einige zentrale Mechanismen:
Magisches Denken: Die kindliche Tendenz, Gedanken eine unmittelbare Wirkung auf die Außenwelt zuzuschreiben (z.B. „Wenn ich ganz fest daran glaube, passiert es“), bleibt auch bei Erwachsenen verborgen aktiv.
Bestätigungsfehler (Confirmation Bias): Wir merken uns Treffer („Das Ritual hat geklappt!“) deutlich stärker als Fehlschläge („Da ist nichts passiert“).
Kontrollillusion: Besonders in Krisen greifen Menschen zu Ritualen, Aberglauben oder Horoskopen, weil sie ein Gefühl von Kontrolle vermitteln – auch wenn sie faktisch nichts ändern.
Dazu kommen Tricks wie Cold Reading, bei denen Wahrsager scheinbar präzise Aussagen machen, die aber aus allgemeinen Aussagen, Rückmeldungen des Gegenübers und geschickter Gesprächsführung entstehen.
Heißt das, alle magischen Erfahrungen sind bloß Fehler im System? So simpel ist es nicht. Für viele Menschen sind sie bedeutungsstiftende Narrative, Werkzeuge für Selbstreflexion oder kreative Ausdrucksformen. Spannend wird es genau da, wo Psychologie und Symbolik aufeinandertreffen.
Von Logen zu #WitchTok: digitaler Okkultismus und Quanten-Mystizismus
Heute findet ein erheblicher Teil des Okkultismus nicht mehr in geheimen Logen, sondern in Feeds und For-You-Pages statt. Auf TikTok trendet der Hashtag #WitchTok mit Milliarden Aufrufen.
Demokratisierung oder nur neue Esoterik-Marke?
In 15-Sekunden-Videos erklären Creator, wie man Sigillen zeichnet, Tarot legt oder „manifestiert“. Junge Menschen teilen Rituale für Liebe, Geld, Karma-Cleansing. Konzepte wie „Reality Shifting“ versprechen Ausflüge in fiktive Welten wie Hogwarts – psychologisch irgendwo zwischen Tagtraum, luzidem Träumen und Dissoziation.
Positiv: Wissen, das früher nur in elitären Zirkeln zirkulierte, wird zugänglich. Menschen finden Community, Sprache für ihre Erfahrungen und kreative Ausdrucksformen.
Problematisch: Die starke Ästhetisierung („Witchy Aesthetic“) und Kommerzialisierung. Manchmal scheint es, als sei das wichtigste magische Utensil die Kreditkarte: Kristalle, Duftkerzen, Tarotdecks, „Moon Water“-Flaschen. Tiefergehende Arbeit an Symbolen, Psychologie oder ethischen Fragen rutscht dabei schnell nach hinten.
Wenn Quanten alles erklären sollen
Ein besonderes Kapitel modernen Online-Okkultismus ist der Quanten-Mystizismus. Begriffe aus der Quantenphysik – Verschränkung, Beobachtereffekt, Nullpunktfeld – werden lose aufgegriffen, um Telepathie, Fernheilung oder „Schwingungserhöhung“ zu begründen.
Das Problem: Quanteneffekte gelten für subatomare Systeme unter sehr speziellen Bedingungen. Sie lassen sich nicht einfach auf Alltagsphänomene übertragen. Der „Beobachtereffekt“ bedeutet in der Physik nicht, dass meine Gedanken das Universum umprogrammieren, sondern dass Messapparaturen mikroskopische Systeme beeinflussen.
Physikerinnen weisen seit Jahren darauf hin, wie verzerrt diese Metaphern verwendet werden. Hier zeigt sich erneut die inszenierte Position des Okkultismus zwischen Wissenschaft und Magie: Das Vokabular der einen Seite soll die Intuitionen der anderen legitimieren – oft auf Kosten der Genauigkeit.
Warum Okkultismus nie verschwindet
Vom ägyptischen Alexandria über die Salons des 19. Jahrhunderts bis in die Feeds der Generation Z zieht sich ein roter Faden: Menschen wollen hinter die Kulissen schauen. Wir ertragen schlecht, dass vieles in unserem Leben zufällig, unfair oder schlicht kompliziert ist. Okkulte Systeme bieten eine Landkarte – manchmal genial poetisch, manchmal brandgefährlich vereinfachend.
Sie können Kreativität befeuern, Kunst inspirieren, persönliche Krisen strukturieren. Sie können aber auch missbraucht werden – für Rassentheorien, für sektenartige Abhängigkeiten, für teure Heilsversprechen ohne wissenschaftliche Grundlage.
Vielleicht ist ein reifer Umgang damit, beides zu sehen: die symbolische Kraft und die Risiken, die psychologischen Mechanismen und die kulturelle Bedeutung. Wir müssen weder alles glauben noch alles verachten. Stattdessen können wir fragen:
Was erzählt dieses System über unsere Ängste und Hoffnungen?
Welche Bedürfnisse erfüllt es, die Wissenschaft (noch) nicht adressiert – und welche sollten besser von Psychologie oder Sozialpolitik aufgefangen werden?
Wo überschreitet es Grenzen, etwa wenn es Menschen von notwendiger medizinischer Behandlung abhält?
Wenn dir dieser Blick auf die Schnittstellen von Okkultismus, Kultur und Wissenschaft gefallen hat, lass dem Beitrag gern ein Like da und schreib in die Kommentare: Welche Form von Magie bist du schon begegnet – auf dem Flohmarkt-Tarotstand, in der Kunst, im Internet?
Und wenn du Lust auf mehr wissenschaftlich-kritische Deep Dives zu Themen wie Esoterik, Popkultur und Psychologie hast, folge mir auf Social Media – dort geht die Diskussion weiter:
#Okkultismus #Esoterik #WitchTok #Hermetik #Thelema #Chaosmagie #WissenschaftUndMagie #Kulturgeschichte #Psychologie #DigitalKultur
Quellen:
Okkultismus – Wikipedia - https://de.wikipedia.org/wiki/Okkultismus
VI.I. Esoterik, Okkultismus und Wissenschaft – Brill - https://brill.com/display/book/9783846748749/B9783846748749_s008.pdf
Okkultismus – Orthpedia - https://orthpedia.de/index.php/Okkultismus
Hermetik – Wikipedia - https://de.wikipedia.org/wiki/Hermetik
Die absurden Thesen der Esoterik | Quantenphysikerin reagiert – YouTube - https://www.youtube.com/watch?v=vAk07GDJ6yg
Geister Gothics Gabelbieger – 66 Antworten auf Fragwürdiges aus Esoterik und Okkultismus - https://dokumen.pub/geister-gothics-gabelbieger-66-antworten-auf-fragwrdiges-aus-esoterik-und-okkulismus.html
Éliphas Lévi – Wikipedia - https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%89liphas_L%C3%A9vi
Hermetic Order of the Golden Dawn – Wikipedia - https://en.wikipedia.org/wiki/Hermetic_Order_of_the_Golden_Dawn
Helena Blavatsky – Wikipedia - https://en.wikipedia.org/wiki/Helena_Blavatsky
Ordo Templi Orientis – Wikipedia - https://en.wikipedia.org/wiki/Ordo_Templi_Orientis
Magick in Theory and Practice – Bauman Rare Books - https://www.baumanrarebooks.com/rare-books/aleister-crowley/magick-in-theory-and-practice/87354.aspx
Kia (magic) – Wikipedia - https://en.wikipedia.org/wiki/Kia_(magic)
Austin Osman Spare: An introduction to his psycho-magical philosophy – Pastelegram - https://pastelegram.org/e/126
Lesser Banishing Ritual of the Pentagram – Joy Vernon - https://joyvernon.com/lesser-banishing-ritual-of-the-pentagram/
Was Wassily Kandinsky Influenced by Hilma af Klint? – TheCollector - https://www.thecollector.com/was-wassily-kandinsky-influenced-by-hilma-af-klint
An Overview – W. B. Yeats and „A Vision“ - https://www.yeatsvision.com/Overview.html
The Necronomicon and the Misappropriation of Ancient Texts - https://isaw.nyu.edu/library/blog/necronomicon
Entzauberung der Welt – Wikipedia - https://de.wikipedia.org/wiki/Entzauberung_der_Welt
Kognitive Verzerrungen: Wenn Ihr Gehirn Ihnen Streiche spielt – Dr. Sonia Jaeger - https://www.sonia-jaeger.com/de/kognitive-verzerrungen-wenn-ihr-gehirn-ihnen-streiche-spielt/
Quantum mysticism is a mistake – IAI TV - https://iai.tv/articles/quantum-mysticism-is-a-mistake-philip-moriarty-auid-2437














































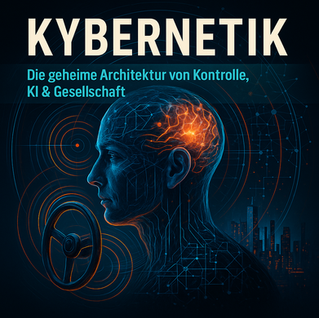

















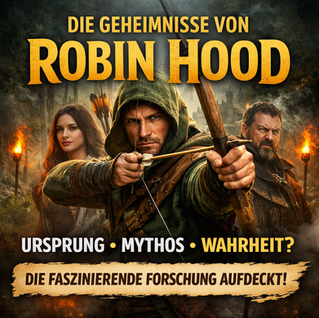





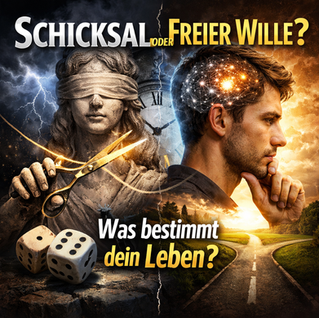




































Kommentare