Entfesseltes Denken: Mit Gilles Deleuze durch den Ideen-Sturm navigieren
- Benjamin Metzig
- 9. Apr. 2025
- 5 Min. Lesezeit

In der Philosophie gibt es ja so einige Schwergewichte, deren Werke erstmal wie eine uneinnehmbare Festung wirken. Gilles Deleuze gehört definitiv in diese Kategorie. Sein Name fällt oft mit einem gewissen Raunen, einer Mischung aus Ehrfurcht und vielleicht auch ein bisschen Einschüchterung. Aber was, wenn ich euch sage, dass genau dieses vermeintlich Stürmische, dieses Wilde in seinem Denken eine unglaubliche Faszination birgt? Stellt euch mal vor, Denken wäre nicht nur ein stilles, geordnetes Sortieren von Gedanken in Schubladen, sondern ein dynamischer, manchmal chaotischer, aber unglaublich kraftvoller Prozess – eben wie ein Sturm.
Gilles Deleuze, geboren 1925 in Paris und dort 1995 verstorben, war einer der einflussreichsten und eigenwilligsten Denker des 20. Jahrhunderts. Zusammen mit seinem kongenialen Partner Félix Guattari hat er ein Werk geschaffen, das bis heute in den Geistes- und Sozialwissenschaften, aber auch in Kunst und Kultur, nachhallt. Wer sich auf Deleuze einlässt, begibt sich auf eine Reise, die gewohnte Denkpfade verlässt. Seine Sprache ist oft dicht, voller Neologismen und überraschender Wendungen. Aber hey, wer hat gesagt, dass das Erkunden neuer geistiger Landschaften immer ein Spaziergang sein muss? Manchmal braucht es eben einen kleinen Sturm, um die Wolken alter Gewissheiten wegzublasen und den Blick freizumachen für etwas Neues.
Was also bedeutet es, zu denken „wie ein Sturm“? Es bedeutet vor allem, Abschied zu nehmen von starren Strukturen und Hierarchien. Deleuze kritisierte das, was er das „baumartige Denken“ nannte – also Denksysteme, die von einem zentralen Stamm ausgehen und sich dann brav in Äste und Zweige unterteilen, immer schön geordnet und nachvollziehbar. Dem stellte er das Konzept des „Rhizoms“ gegenüber. Denkt an Ingwer oder an das unterirdische Geflecht von Pilzen, ein Myzel. Ein Rhizom hat keinen Anfang und kein Ende, keinen zentralen Punkt, sondern breitet sich in alle Richtungen aus, knüpft ständig neue Verbindungen, kann an jeder Stelle unterbrochen und wieder neu angesetzt werden. Es ist ein Netzwerk, dezentral, dynamisch, unvorhersehbar – wie die Ausläufer eines Sturms, die sich ihren eigenen Weg suchen.
Dieses rhizomatische Denken hat weitreichende Konsequenzen. Es fordert uns heraus, die Welt nicht mehr in klar getrennten Kategorien zu sehen, sondern als ein Feld von fließenden Übergängen und komplexen Verknüpfungen. Wissenschaft, Kunst, Politik, Alltag – alles ist potenziell miteinander verbunden, beeinflusst sich gegenseitig. Statt nach dem einen Ursprung oder der ultimativen Wahrheit zu suchen, lädt uns Deleuze ein, die Vielfalt der Verbindungen, die Multiplizität zu erkunden. Es geht nicht darum, was etwas ist, sondern wie es funktioniert, womit es in Verbindung tritt, welche Kräfte in ihm wirken. Das ist doch mal eine erfrischende Perspektive, oder? Weg von der statischen Identität, hin zur dynamischen Funktion.
Ein weiteres zentrales Element im Denken Deleuzes ist das Konzept des „Werdens“ (Devenir). Nichts ist jemals wirklich fertig, alles ist im Prozess, in ständiger Transformation. Wir sind nicht einfach nur „Mensch“, sondern wir sind im ständigen Werden – Werden-Tier, Werden-Pflanze, Werden-Musik, Werden-Intensität. Das klingt erstmal vielleicht poetisch oder gar esoterisch, meint aber etwas sehr Konkretes: Es geht darum, sich von festgefahrenen Identitäten zu lösen und die Linien zu erkunden, die uns mit anderen Seinsweisen verbinden, die uns verändern und neue Möglichkeiten eröffnen. Denkt an einen Musiker, der in seinem Spiel „eins wird“ mit dem Instrument, oder an einen Läufer, der im Rausch der Bewegung die Grenzen seines Körpers zu spüren meint. Dieses Werden ist kein Nachahmen, sondern ein Eintreten in eine Zone der Ununterscheidbarkeit, eine Intensivierung des Lebens. Falls ihr tiefer in solche transformativen Ideen eintauchen wollt, unser monatlicher Newsletter hält euch über spannende Denkanstöße auf dem Laufenden – meldet euch doch einfach über das Formular oben auf der Seite an!
Eng damit verbunden ist Deleuzes Verständnis von „Differenz und Wiederholung“. Normalerweise denken wir bei Wiederholung an das Immergleiche. Deleuze aber betont die produktive Kraft der Wiederholung. Jede Wiederholung, so argumentiert er, ist nie eine exakte Kopie, sondern bringt immer eine kleine Verschiebung, eine Differenz hervor. Denkt an das Üben eines Musikstücks: Jede Wiederholung ist anders, verfeinert, variiert, schafft etwas Neues. Oder an die Evolution: Wiederholung genetischer Muster, aber mit Variationen, die zur Entstehung neuer Arten führen. Das Leben selbst ist für Deleuze eine ständige Produktion von Differenz durch Wiederholung. Der Sturm wiederholt sich auch nie exakt, jede Böe, jede Wolkenformation ist einzigartig und doch Teil des gleichen dynamischen Prozesses.
Zusammen mit Guattari entwickelte Deleuze in Werken wie „Anti-Ödipus“ und „Tausend Plateaus“ auch die kontroverse Idee der „Wunschmaschinen“. Hier geht es nicht um den Wunsch als Mangel (ich will etwas, das ich nicht habe), sondern um den Wunsch als eine produktive, treibende Kraft, die ständig Verbindungen herstellt und Flüsse erzeugt – Ströme von Energie, Materie, Zeichen. Gesellschaft, Psyche, Körper – alles wird als ein komplexes Gefüge von solchen Wunschmaschinen betrachtet, die mal blockiert werden, mal revolutionäre Potenziale freisetzen. Das ist zugegebenermaßen harter Tobak, aber es zeigt Deleuzes radikalen Versuch, Denkkategorien aufzubrechen und Prozesse statt Zustände in den Mittelpunkt zu rücken. Wie ein Sturm, der Energien bündelt und Landschaften umgestaltet.
Was bringt uns das alles heute? Leben wir nicht in einer Zeit, die komplexer, vernetzter und unvorhersehbarer ist als je zuvor? Die alten, baumartigen Ordnungen – sei es in der Politik, der Wirtschaft oder unserem persönlichen Leben – scheinen oft nicht mehr zu greifen. Deleuzes Denken, so herausfordernd es sein mag, bietet uns Werkzeuge, um mit dieser Komplexität umzugehen. Es ermutigt uns, flexibel zu denken, Verbindungen zu sehen, wo vorher nur Trennungen waren, und das Potenzial für Veränderung und Neuschöpfung im Unerwarteten zu erkennen. Es ist eine Philosophie, die uns dazu auffordert, aktiv zu werden, zu experimentieren, neue Wege des Denkens und Lebens zu erproben. Was meint ihr dazu? Findet ihr solche Ansätze hilfreich, um unsere heutige Welt zu verstehen? Lasst es mich unbedingt in den Kommentaren wissen und gebt dem Beitrag ein Like, wenn er euch zum Nachdenken angeregt hat!
Natürlich ist Deleuze kein Allheilmittel und seine Texte sind, seien wir ehrlich, oft eine echte Herausforderung. Manchmal fühlt man sich beim Lesen tatsächlich wie mitten in einem Ideen-Sturm, hin- und hergeworfen von Begriffen und Konzepten, die sich einer einfachen Einordnung widersetzen. Aber vielleicht liegt genau darin auch der Reiz. Deleuze zwingt uns, unsere intellektuellen Komfortzonen zu verlassen, uns auf Ungewissheit einzulassen und die Schönheit im Komplexen und Fließenden zu entdecken. Es geht nicht darum, ihn auf eine simple Formel zu reduzieren, sondern sich von seiner Energie anstecken zu lassen.
Sein Denken lädt uns ein, die Welt als ein Feld unendlicher Möglichkeiten zu betrachten, als ein dynamisches Gewebe von Kräften und Intensitäten. Es ist ein Appell, kreativ zu sein, nicht nur in der Kunst, sondern im Denken selbst. Linien ziehen, Verbindungen knüpfen, Fluchtwege aus festgefahrenen Mustern suchen – das sind die Bewegungen, zu denen uns Deleuze inspiriert. Wer sich intensiver mit solchen Grenzgängen des Denkens beschäftigen möchte, findet auf unseren Kanälen bei Facebook und Instagram regelmäßig neue Impulse und Diskussionen. Folgt uns doch unter den Links hier: https://www.instagram.com/wissenschaftswelle.de/ und https://www.facebook.com/Wissenschaftswelle – wir freuen uns auf den Austausch!
Vielleicht ist es also gar nicht so schlecht, wenn das Denken manchmal wie ein Sturm ist. Ein Sturm räumt auf, wirbelt durcheinander, schafft Platz für Neues. Er ist unkontrollierbar, ja, aber auch voller Kraft und Energie. Sich auf Deleuze einzulassen bedeutet, diese Energie für das eigene Denken nutzbar zu machen, die Fenster aufzureißen und frischen Wind hereinzulassen – auch wenn dabei mal ein paar alte Papiere vom Schreibtisch geweht werden.
Letztlich geht es bei Deleuze, so scheint mir, um eine tiefgreifende Bejahung des Lebens in all seiner Komplexität, Veränderlichkeit und Intensität. Es ist eine Philosophie, die uns nicht sagt, was wir denken sollen, sondern wie wir denken könnten – offener, dynamischer, vernetzter, mutiger. Und in einer Welt, die uns ständig vor neue Herausforderungen stellt, ist das vielleicht eine der wertvollsten Fähigkeiten, die wir kultivieren können. Das Denken als Abenteuer, als Entdeckungsreise ins Unbekannte – ist das nicht eine aufregende Vorstellung?














































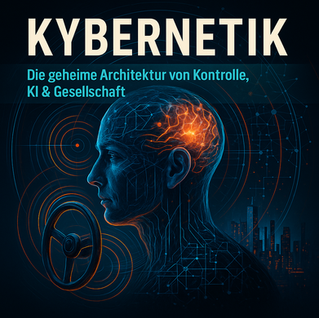

















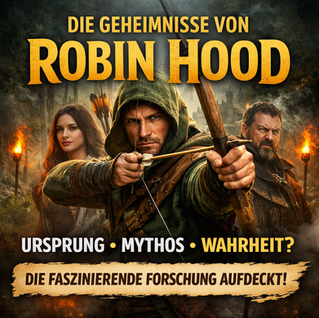





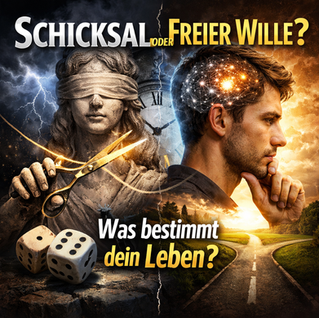




































Kommentare